
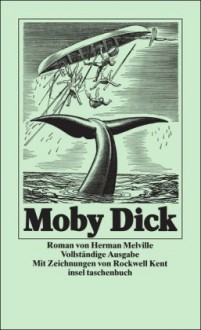
Der Mann, der niemals irgendwo gescheitert ist, kann nicht groß werden. – Herman Melville
Die Biografin Laurie Robertson-Lorant schrieb über Herman Melville, man könne ihn entweder als gescheiterten Schriftsteller charakterisieren oder als verkanntes Genie und Visionär. Melville gehört zu den tragischen Figuren der Literaturgeschichte, die erst weit nach ihrem Tod die Anerkennung erlangten, die sie verdienen.
1819 in New York geboren, nach einer Kindheit, die vom Bankrott seines ehemals wohlhabenden Vaters geprägt war, fuhr Melville im Alter von 20 zur See und erlebte fünf äußerst turbulente Jahre auf Handelsschiffen, Walfängern und sogar einer Kriegsfregatte. Er desertierte, heuerte wieder an, war Teil einer Meuterei, wurde ins Gefängnis geworfen, floh und bereiste weite Teile des Atlantiks und Pazifiks. Er war ein Abenteurer. Zurück in New York verarbeitete er seine Erlebnisse in zwei erfolgreichen, überwiegend fiktiven Reisedokumentationen, „Typee“ (1846) und „Omoo“ (1847). Leider stellten diese beiden Romane bereits den Höhepunkt seiner literarischen Karriere dar, an den er nie wieder anknüpfen konnte. Nicht einmal mit dem Buch, für das er heute am besten bekannt ist: „Moby-Dick“.
Melville litt unter der gesellschaftlichen Zurückweisung, erkrankte an Depressionen und konnte sich nur schwer mit der Missachtung der Kritiker abfinden. Dennoch gab er das Schreiben niemals auf, veröffentlichte weiterhin Romane und Kurzgeschichten und wandte sich vermehrt der Lyrik zu. Als er im September 1891 im Alter von 72 Jahren starb, hinterließ er die unveröffentlichte Gedichtsammlung „Weeds and Wildings“ und ein fragmentarisches Manuskript namens „Billy Budd“, das erst 1919 von seinem Biografen Richard Weaver entdeckt und 1924 überarbeitet veröffentlicht wurde. Bei seinem Tod war der kurzzeitige literarische Star Herman Melville längst in Vergessenheit geraten. Die New York Times widmete seinem Nachruf lediglich ein paar Zeilen.
Rückblickend geht man davon aus, dass Melville seiner Epoche zu weit voraus war. In seinen Werken finden sich Techniken und Stilmittel, die erst in den 1920er Jahren populär wurden und seine zeitgenössische Leserschaft überforderten. Es überrascht daher nicht, dass Melville auch erst anlässlich seines 100. Geburtstags wiederentdeckt und sein literarisches Schaffen neubewertet wurde. Seitdem gilt er als Vorreiter der Moderne und als einer der Väter der US-amerikanischen Literatur, an dem sich Literaturwissenschaftler_innen aus verschiedensten Perspektiven abarbeiten.
„Moby-Dick“, Melvilles monumentaler Roman, erschien 1851. Die Druckgeschichte des Buches wirkt aus heutiger Sicht absurd: der Setzer arbeitete bereits daran, während Melville noch schrieb und Korrekturen anordnete. Das ursprüngliche Manuskript ist nicht erhalten, ein für Melville-Forscher_innen unglücklicher Umstand, weil „Moby-Dick“ zwar in England und den USA mit nur etwa einem Monat Abstand originalveröffentlicht wurde, sich die beiden Ausgaben jedoch stark unterschieden. Die britische Ausgabe wurde Opfer der Zensur, die „antiroyalistische“ und religionskritische Passagen strich. Außerdem fehlte der Epilog. Die US-amerikanische Ausgabe hingegen verzichtete auf viele der nachträglichen Änderungen, weil diese nicht mehr eingearbeitet werden konnten. Trotz dessen konnten beide Versionen ein literaturhistorisches Novum vorweisen. Die britische Ausgabe erschien unter dem unspezifischen Titel „The Whale“; auf dem US-amerikanischen Cover war „Moby-Dick; or, The Whale“ zu lesen. Damit war dies der allererste Roman, dessen titelgebende Hauptfigur ein Tier war, noch dazu mit Eigennamen.
Für mich entwickelte „Moby-Dick“ über die Jahre ohne mein Zutun eine beinahe unheimliche Eigendynamik. Ich hatte immer vor, das Buch zu lesen, dieses Schwergewicht unter den Klassikern. In meiner Vorstellung lag ich im hohen Alter auf meinem Sterbebett und flüsterte „Aber den Wal, den hab ich gelesen“. Das mag seltsam klingen, aber ich glaube, dass viele Leser_innen sich literarische Meilensteine setzen, die sie im Laufe ihres Lebens unbedingt abhaken wollen. Für mich war es eben „Moby-Dick“.
Im Juni 2015 lachte mich eine günstige deutsche Ausgabe von dem Wühltisch eines Antiquariats an, die ich freudig und kurzentschlossen mit heimnahm. Es war das letzte Mal für lange Zeit, dass mir das Buch positive Emotionen vermittelte.
Anfangs betrachtete ich den Wal in meinem Bücherregal mit der üblichen Zutraulichkeit. Ich vertraute darauf, dass seine Zeit kommen würde und setzte mich nicht unter Druck. Doch die Jahre vergingen und irgendwie gelang es dem Wal, zunehmend Raum in meinem Hinterkopf einzunehmen und darin herumzuspuken. Wann immer das Thema auf Bücher kam, die ich längst gelesen haben wollte, schlug er heftig mit seiner Schwanzflosse und machte auf sich aufmerksam. Ich stellte fest, dass mich die ausstehende Lektüre einschüchterte. Es ist ein dickes Werk von über 800 Seiten, geschrieben in einer Zeit, in der Eingängigkeit noch nicht als Ziel der Literatur verstanden wurde. Ich begann, bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit anderen Leser_innen über „Moby-Dick“ zu sprechen, um aus ihren Erfahrungen eine Ahnung dafür zu entwickeln, was mich erwartete und meine Ängste zu lindern. Leider hatte diese Taktik eher den gegenteiligen Effekt. Langweilig und langatmig sei der Wal, eine Qual und überhaupt keine angenehme Lektüre.
Mir schlotterten die Knie. In meinem Kopf verwuchs sich das Buch „Moby-Dick“ mit seinem tierischen Titelhelden und ich verwandelte mich in eine abstruse Version von Kapitän Ahab: das Subjekt der Begierde und der obsessive Jäger (bzw. die Jägerin), auf ewig vereint in einem unvollendeten Tanz. Ich hatte die Befürchtung, niemals bereit zu sein. Ich sehnte und bangte dem Moment gleichermaßen entgegen.
Dann wurde ich im Juni 2019 nach meinen „SuB-Leichen der Schande“ gefragt, also nach ungelesenen Büchern, die ich schon lange vor mir herschiebe. Der weiße Wal in meinem Kopf flippte aus. Er veranstaltete einen spektakulären Zirkus und überflutete mich mit Wellen des schlechten Gewissens. Ich begriff, dass ich längst bereit war. Meine Sorgen, mein Respekt vor der Lektüre, blockierten mich. Als mir das klar wurde, regte sich endlich mein alter Freund, der Trotz. Ich ärgerte mich über mich selbst und entschied, dass ich dem Wal nicht länger erlauben wollte, munter vorwurfsvoll durch meinen Geist zu planschen. Es reichte. Daher nahm ich im Juli 2019 meinen ganzen Mut zusammen und holte ihn aus dem Regal. Ich würde es schaffen. Ich würde „Moby-Dick“ lesen und den weißen Wal erlegen. Komme, was da wolle.
Treiben ihn Geldnot und Fernweh um, fährt Ismael als Matrose zur See. Nach Jahren, in denen er sich auf Handelsschiffen verdingte, will er erstmals auf einem Walfänger anheuern und reist nach Nantucket, in das stolze Herz des US-amerikanischen Walfangs. Drei Schiffe liegen dort zum Auslaufen bereit. Das Schicksal führt ihn auf die Pequod und in die Arme des finsteren Kapitän Ahab. Ahab ist ein Veteran des Walfangs, weitgereist und mit jeder Unbill der eifersüchtigen See vertraut. Doch seit seiner letzten Reise brennt die unheilige Flamme des Hasses in ihm. Damals traf er auf Moby Dick, den legendären weißen Wal, den gefürchteten Leviathan und musste ihm sein Bein opfern. Seitdem wird Ahab von erbarmungslosen Rachegelüsten gepeinigt. Um jeden Preis will er den weißen Wal erlegen und schreckt nicht davor zurück, die Besatzung der Pequod auf seine obsessive Jagd einzuschwören. Der Atem des Todes bläht die Segel auf ihrer verhängnisvollen Fahrt…
Sieg! Es ist mir gelungen! Ich habe den weißen Wal bezwungen! Und wisst ihr was? Es war viel weniger schlimm, als ich befürchtet hatte. So ist das ja oft im Leben. Natürlich muss man während der Lektüre damit zurechtkommen, dass „Moby-Dick“ grundsätzlich sehr weitschweifig, ausholend und überwältigend detailverliebt ist. Ja, manchmal erscheint es langatmig, manchmal langweilig und manchmal beides. Aber eben nicht nur.
Der Klassiker, der Herman Melville unsterblich machte, enthält durchaus spannende und interessante Passagen und strotzt nur so vor Wissen. Aus der Ich-Perspektive des neunmalklugen Matrosen Ismael, der sich gleichermaßen als Chronist, Kommentator und Dozent versteht, vermittelt Melville zahlreiche Informationen, die ich als Bereicherung empfand. Ich weiß jetzt alles, was es über den US-amerikanischen Walfang im 19. Jahrhundert zu wissen gibt. Seine Darstellungen wirkten auf mich äußerst akkurat; man spürt, dass der Autor eigene Erfahrungen sammelte und höchstpersönlich erlebte, wie Wale auf offener See gejagt, erlegt und verarbeitet wurden. Dieser reiche Erinnerungsschatz befähigte ihn, jeden noch so winzigen Aspekt der Walerei eingehend zu beleuchten.
Mich faszinierten vor allem seine Ausführungen über die Cetologie, die Wissenschaft der Wale, die ich neugierig mit aktuellen Wikipedia-Artikeln abglich. Es erstaunte mich, dass sich unsere Erkenntnisse über Pottwale seit 1851 kaum erweiterten. Noch immer ist die Tragzeit von Pottwalkühen unbekannt, ebenso wie die Funktion des Spermaceti, das feine Öl in den Köpfen der Pottwale, das auch Walrat genannt wird und der Hauptgrund für die Pottwaljagd war. Die maximale Tauchtiefe der Meereskolosse kann lediglich anhand von Nahrungsresten, die in den Mägen verendeter Exemplare gefunden wurden, gemutmaßt werden. 3000 Meter und mehr sind möglich. All diese Punkte sprach Melville bereits an, was mir bewusst machte, wie unerforscht die Tiefsee bis heute ist. Prinzipiell war mir das lange vor der Lektüre von „Moby-Dick“ klar, doch schwarz auf weiß zu lesen, dass sich der Wissensstand über Pottwale in über 150 Jahren nur minimal vergrößerte, transportierte diesen Fakt in eine für mich greifbare Realität.
Auf andere Wissensfelder, die Melville erläutert, hätte ich hingegen gut verzichten können. Ich hätte wunderbar weiterleben können, ohne genauestens über die Beschaffenheit und Einsatzmöglichkeiten diverser Leinen, Haken und anderer Hilfsmittel auf einem Walfänger informiert zu werden. Ich gebe zu, hin und wieder langweilte ich mich fürchterlich, doch ich kann Melville seine Akribie verzeihen, weil ich durchaus einsehe, dass er ein vollständiges Bild des Walfangs anfertigen wollte. Es ist nun mal wichtig, zu visualisieren, wie eine Leine durch ein kleines Fangboot lief, um zu verstehen, warum von dieser eine große Gefahr für die Mannschaft ausging, die ihr in unglücklichen Fällen Körperteile oder gar gleich das Leben opfern musste, wenn ihr Zug die Matrosen ins offene Meer warf. Außerdem half es mir, dass Melville überwiegend kurze Kapitel einsetzte. Es fiel mir dadurch leichter, mich durch einschläfernde Abschnitte durchzubeißen, denn ich hangelte mich an der Aussicht entlang, dass es bald wieder besser werden würde. Tatsächlich gilt die exzessive Unterteilung von „Moby-Dick“ als Markenzeichen Melvilles und wurde von Literaturwissenschaftler_innen sinngemäß als „seine Methode der Beherrschung der Schreibkunst“ bezeichnet.
Wer nun allerdings glaubt, „Moby-Dick“ sei nicht mehr als eine Abfolge von Beschreibungen des Walfangalltags, irrt gewaltig. Schließlich ist da ja immer noch der gruselige Kapitän Ahab und seine wahnhafte Rachemission. Diese grundlegende Handlungslinie verlor Melville niemals aus den Augen, häufig zeigt sie sich jedoch subtil, indirekt und primär durch die Atmosphäre, die die Pequod umgibt. Melville gelang es hervorragend, seinem Roman eine metaphysische Ebene zu verleihen, auf der er die kommenden katastrophalen Ereignisse bereits vorzeichnete. Die Handlung selbst weist eine deutlich wahrnehmbare Zuspitzung auf, eine Abwärtsspirale, die von wachsender Manie und Unausweichlichkeit gekennzeichnet ist. Je weiter sich die Pequod von Nantucket entfernt, desto häufiger erfährt die Mannschaft von Sichtungen des weißen Wals und desto fieberhafter gestaltet sich ihre Jagd. Den Einfluss von Ahab empfand ich dabei als beklemmend unheimlich. Seine Obsession vereinnahmt Stück für Stück den Rhythmus seines Schiffes und infiziert die Besatzung, bis seine irrationale Fehde mit Moby Dick auch die ihre und nichts anderes mehr von Belang ist.
Ahab ist eine finstere Figur, der ich außerhalb der Seiten des Buches wirklich nicht begegnen möchte. Er strahlt eine autoritäre Aura der Selbstzerstörung aus, die mich einschüchterte, meinen Mund austrocknete und mir Schauer über den Rücken jagte. Sein vernunftwidriger Hass auf ein Tier, dem er willentlich bösartige Absichten unterstellt, auf das er scheinbar alles Negative der Welt und in seinem Leben projiziert, ist einfach verrückt. Unter Seeleuten hatte Aberglaube damals eine gewisse Tradition (vielleicht ist das heute noch so), doch angesichts all des Wissens, das Ismael aufzählt, kann ich mir nicht vorstellen, dass Wale tatsächlich noch für Seeungeheuer gehalten wurden. Deshalb steht die grundsätzlich sehr realistische Darstellung des Lebens auf einem Walfänger, um die sich Melville bemühte, in krassem Kontrast zu Ahabs psychotisch-paranoider Überzeugung, sich in einem privaten, gegenseitigen Krieg mit Moby Dick zu befinden. Ich denke, dieser Widerspruch ist beabsichtigt, weil ich glaube, dass Melville gezielt einen Charakter erschaffen wollte, dessen innere Dämonen sich in dem ewigen Kampf zwischen Mensch und Natur widerspiegeln. Ahab trägt vielmehr den Konflikt mit sich selbst als den Konflikt mit Moby Dick aus. Ich hatte sogar das Gefühl, dass der düstere Kapitän den Tod sucht und gar nicht damit rechnet, heimzukehren. Selbstmord durch Wal.
Die Frage, die sich mir deshalb aufdrängte, lautet: geht es in „Moby-Dick“ überhaupt um Moby Dick? Meiner Meinung nach nicht. Schließlich taucht der weiße Wal erst ganz am Ende des Buches auf und ist in der übrigen Zeit eher ein substanzloses Phantom, ein Gerücht, dem die Pequod nachjagt. Ich glaube, „Moby-Dick“ ist einerseits eine Art Imagekampagne für den damals stark mit Vorurteilen, Unglaube und Missbilligung behafteten Walfang und andererseits eine tiefsinnige Untersuchung des Kampfes des Menschen mit den dunklen Abgründen seiner Seele. Der Wal Moby Dick dient lediglich als Medium.
Es wundert mich nicht, dass diese anspruchsvolle, komplexe und unkonventionelle Kombination Melvilles damaliges Publikum überforderte. Ich bin keine Literaturhistorikerin, aber ich vermute, dass die Leserschaft zu dieser Zeit noch nicht daran gewöhnt war, zwischen den Zeilen nach versteckten Bedeutungen zu fahnden und die Atmosphäre als existenziellen Bestandteil der Handlung zu interpretieren. Demzufolge glaube auch ich, dass Herman Melville seiner Epoche weit voraus war. Es ist bedauerlich, dass er nie erleben konnte, wie sein großer Roman zum Klassiker der Weltliteratur erhoben wurde.
Für mich war „Moby-Dick“ ein überraschend flüssig geschriebener Klassiker, der mich deutlich weniger folterte, als ich angenommen hatte. Die Lektüre war kein überschäumender Spaß, denn die vielen umfassenden Schilderungen des Walfängeralltags sind definitiv nicht immer reizvoll und manchmal verfluchte ich Ismael dafür, dass er nicht einfach zum Punkt kommen konnte und unterstellte ihm, sich selbst allzu gern reden zu hören, aber dennoch hatte ich den Eindruck, dass für das Gesamtwerk kein Satz, kein Wort überflüssig ist. Alles hat seinen Platz in Melvilles Komposition und erfüllt einen Zweck. Das Buch hat mir neues, spannendes Wissen vermittelt und meine Gedanken stimuliert, ganz so, wie Melville es meiner Ansicht nach beabsichtigte. Ich finde, dass „Moby-Dick“ seinen Status als Weltliteratur verdient, allerdings weniger aufgrund der Geschichte an sich, sondern aufgrund der Geschichte im historischen Kontext. Es ist beeindruckend, wie experimentell Melville vorging, wie mutig er Stilmittel einsetzte, die damals noch nicht zum guten literarischen Ton gehörten und auf diese Weise eine Erzählung niederschrieb, die bis heute viele Interpretationsansätze zulässt. Ich bin stolz, „Moby-Dick“ endlich gelesen zu haben. Jetzt kann ich beruhigt sterben und auf meinem Totenbett berichten, dass ich den Wal erlegt habe.

 Log in with Facebook
Log in with Facebook 






