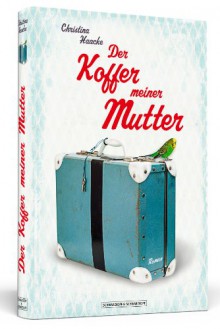Maxim Billers jüdischer Generationenroman steht auf der Longlist für den deutschen Buchpreis. Zentrales Thema der beschriebenen Mischpoche ist, wer aus der Familie den Großvater – also den Taten* Schmiel Grigoriewitsch – beim KGB denunziert hat, was zu dessen Hinrichtung führte. Quasi als Beiwerk zu dieser Kernfrage werden sehr viel Historisches, die Verlorenheit der Diaspora, jüdische Identität, Familiengeheimnisse, Zank, Neid, Beschuldigungen und Liebesgeschichten vermittelt und das auch noch aus vielen Perspektiven – nämlich aus der Sicht der unterschiedlichen Familienmitglieder beleuchtet.
Jetzt stellt sich natürlich die Einserfrage, ob ich finde, dass die Nominierung gerechtfertigt ist. Zuerst möchte ich aber ausholen, warum ich glaube, das Buch neutraler bewerten zu können als viele andere. Mir ist als Österreicherin ehrlich gesagt der deutsche Literaturbetrieb nicht ganz so geläufig. Ich kenne weder die Verleger noch die intellektuellen Kritiker in den deutschen Zeitungen und im Fernsehen (bis auf Dennis Scheck), insofern habe ich Maxim Biller bisher weder gesehen noch gehört noch gelesen. Ich kann also den Roman abseits der Person Biller bewerten, ohne dass die Persönlichkeit des Autors in meine Beurteilung einfließt. Weiters liebe ich jüdische Familiengeschichten, habe vor allem ein Faible für Amoz Oz, Edgar Hilsenrath und André Kaminski, als 10-jährige habe ich schon alle Satiren von Ephraim Kishon verschlungen.
Tja, und nun kommt die Antwort auf die zuvor formulierte Einserfrage, und die lautet: Ich bin am Ende – nämlich auf der letzten Seite der Geschichte – einfach nicht so begeistert, wie ich es ursprünglich gedacht und eigentlich gehofft habe. Aber beginnen wir mit den Pluspunkten des Romans.
Er ist nicht so episch breit und ausladend, wie viele andere jüdische Romane. Maxim Biller beweist, dass auch auf knapp 200 Seiten sehr viel und auch ausreichend tief eine komplexe Familienstory und jüdische Identität transportiert werden kann. Insofern ist dieser kurze Roman recht innovativ. Auch die unterschiedlichen Sichtweisen der Familienmitglieder, von denen jeder Einzelne einen Ausschnitt der Ereignisse vermittelt, haben mir ausnehmend gut gefallen.
Sprachlich und philosophisch ist die Geschichte sowieso großartig. So rüttelt einer der jugendlichen Protagonisten sehr ungestüm am Säulenheiligen der deutschen Literatur, Bert Brecht, das ist mutig und sehr witzig.
Ich las zum vierten, fünften Mal denselben Satz – „In großen Zeiten stören Leute wie ich das harmonische Bild“ – ich dachte was für eine kokette Scheiße und dann machte ich Etties kleine rote Nachttischlampe aus … .
… und macht sich als 15-jähriger zwischendurch auch mal sehr kluge Gedanken, wie er in der Situation der Generation seiner Eltern bei einem Verhör durch den aufgebauten Druck der kommunistischen Organe wirklich reagiert hätte.
Onkel Dima hatte Recht. Ich war ein kleiner gemeiner Berija, ein Besserwisser, ein eingebildeter, ahnungsloser Teenager, dessen größte Sorge es war, dass er von seinem Vater nicht beim Rauchen erwischt wurde und dass seine Mutter nicht die Taschentücher unter seinem Bett fand, mit denen er sich nach dem Onanieren abwischte […]. Was hätte ich, dachte ich, damals eigentlich an Dimas Stelle oder an der Stelle meiner Eltern getan? Wäre ich geblieben, wäre ich geflohen, hätte ich selbst meine engsten Freunde und Verwandte verraten, wenn die Kommunisten mich erwischt hätten?
Bedauerlicherweise verweigert Maxim Biller mir als Leserin die zentrale Kernfrage der Familie, den Ausgangspunkt des Romans und im Prinzip das aufgelöste Rätsel am Ende der Geschichte. Immer wenn es brenzlig wird, blendet er weg. Die Stasiakte von Onkel Dima wird nicht fertiggelesen und – was noch viel schlimmer ist – der Brief von Natalia, der alles klären soll, wird weder fertiggelesen, noch in dem Interview besprochen. Und das Gemeinste ist der letzte Satz des Romans, denn alle, wirklich alle Figuren im Buch wissen letztendlich wer den Taten* verraten hat, nur der Leser tappt düpiert im Dunkeln und kann sich sein Ende selbst konzipieren.
„Nein, das verstehe ich eigentlich nicht“, sagte die Moderatorin höflich und plötzlich sehr streng, und dann erzählte ihr Jelena, wie es wirklich gewesen war.
Ich finde so ein Stilmittel als Abschluss weder innovativ noch philosophisch, sondern nur schlechte Arbeit. Das ist so hundsgemein, das habe ich mir als Leserin einfach nicht verdient, dass mir, nachdem ich mich mit den Figuren angefreundet und mit ihnen gelitten habe, die Auflösung des Falls – das Geheimnis der Familie – so schändlich vorenthalten wird. Da fühle ich mich wirklich verarscht, vor allem, weil ich persönlich manisch Plot orientiert bin.
Fazit: Gute Geschichte mit einem wirklich scheußlich konstruierten Ende.
*Tate = Vater jiddisch

 Log in with Facebook
Log in with Facebook