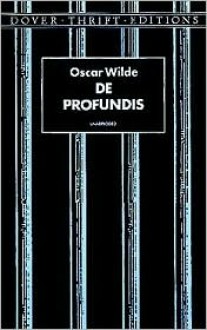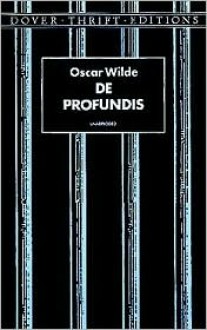
Dies ist keine gewöhnliche Rezension. Vielleicht ist euch bereits aufgefallen, dass ich dieses Mal auf eine Sternevergabe verzichtet habe. Ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich glaube, dass „Epistola in Carcere et Vinculis“ oder auch kurz „De Profundis“ von Oscar Wilde es nicht verdient, mit einer plumpen Sternenanzahl beurteilt zu werden. Bei dem Text handelt es sich um einen Brief von etwa 50.000 Worten, den Wilde während seiner Zeit im Zuchthaus von 1895 bis 1897 an seinen ehemaligen Liebhaber Lord Alfred Bruce Douglas schrieb. Wie anmaßend wäre es, ein Schriftstück bewerten zu wollen, in dem ein verzweifelter Mann sein Innerstes nach außen kehrte und niederschrieb, was ihn bewegte?
Daher habe ich beschlossen, von der gewohnten Struktur meiner Rezensionen Abstand zu nehmen und diesen berührenden Brief vollkommen eigenständig zu besprechen. Es ist kein Roman. Es ist keine Geschichte, obwohl der Text durchaus eine Geschichte erzählt. Ich kann meine üblichen Maßstäbe hier nicht anlegen. Stattdessen möchte ich euch zuerst die historischen Fakten darlegen, bevor ich erkläre, wie „De Profundis“ auf mich wirkte und welche Schlussfolgerungen ich daraus ziehe. Es ist das tragische Zeugnis eines gebrochenen Mannes, das ihr ohne Kontext nicht verstehen werdet. Ich war entsetzt, was aus dem ehemals erfolgreichen Autor Oscar Wilde geworden war.

Oscar Wilde ging stets recht offen mit seiner Homosexualität um. Obwohl er verheiratet war und mit seiner Frau Kinder gezeugt hatte, machte er nie einen Hehl daraus, dass er sich zu Männern sexuell und emotional hingezogen fühlte. Er arbeitete seine persönlichen Vorlieben in seine Werke ein, die nachweislich homoerotische Unterströmungen beinhalten. Trotz dessen wäre er vielleicht nie im Gefängnis gelandet, hätte er im Juni 1891 nicht die Bekanntschaft von Lord Alfred Bruce Douglas gemacht. Die Details ihres Kennenlernens konnte ich leider nicht herausfinden, in „De Profundis“ deutet Wilde allerdings an, dass Douglas sich als Oxford-Student mit einem Problem an ihn wandte und um Hilfe bat. Die beiden Männer trennte ein Altersunterschied von 16 Jahren; 1891 war Wilde 37, Douglas – genannt Bosie – 21 Jahre alt. Sie waren ein halbes Jahr befreundet, bevor sie eine Liebesbeziehung eingingen. Diese hatte anfangs wohl eine sexuelle Komponente, Wilde und Douglas berichteten jedoch beide, dass diese nur kurz währte und ihre Affäre fortan rein emotionaler Natur war.
Die Beziehung zwischen Wilde und Douglas war turbulent und dramatisch. Sie stritten oft, hauptsächlich wegen der ungeheuren Summen, die der vergnügungssüchtige Douglas täglich verprasste. Er war es auch, der Wilde in die geheime Welt der männlichen Prostituierten einführte. Er ließ sich wie selbstverständlich von seinem älteren Liebhaber aushalten und pflegte einen extravaganten Lebensstil, den der aus dem Bürgertum stammende, disziplinierte Autor nur schwerlich nachvollziehen konnte. Obwohl Oscar Wilde öffentlich als Bon-Vivant und Dandy bekannt war, nahm er seine Arbeit sehr ernst und zeigte sich hinsichtlich seiner Texte als unverbesserlicher Perfektionist.
Douglas‘ Leben war allzeit von dem schwierigen, konfliktbelasteten Verhältnis zu seinem Vater, dem 9. Marquis von Queensberry, geprägt. Dieser hatte seinem flatterhaften Sohn stets jegliche Anerkennung verwehrt und war demzufolge höchstwahrscheinlich indirekt dafür verantwortlich, dass Douglas sich auf eine Beziehung zu einem deutlich älteren Mann einließ. Daddy Issues aus dem Lehrbuch. Der Marquis vermutete, dass zwischen Wilde und Douglas mehr als eine Freundschaft existierte und verlieh seinem Verdacht 1895 Ausdruck, indem er seine Visitenkarte im Albemarle Club (ein Etablissement, das Wilde oft besuchte) hinterließ, die er mit der beleidigenden Aufschrift „Für Oscar Wilde / posierenden Sodomiten“ („For Oscar Wilde posing Somdomite [sic!]“) versehen hatte. Von selbst hätte Wilde auf diese Beschimpfung möglicherweise nicht reagiert, er ließ sich jedoch von Douglas zu einer Verleumdungsklage drängen, entgegen des Rats seiner Freunde. Douglas war entzückt von der Vorstellung, seinem Vater eins auswischen zu können und scheute sich nicht, seinen Liebhaber für seine Rache einzuspannen. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Als Beklagter fiel es dem Marquis zu seiner Verteidigung zu, den Wahrheitsgehalt seiner Beschuldigung zu beweisen. Das Blatt wendete sich, Wilde wurde vom Kläger zum Angeklagten und musste sich plötzlich selbst verteidigen. Er wurde verhaftet und wegen Unzucht angeklagt. Er verlor den Prozess. Am 25.05.1895 wurde er zu 2 Jahren Zuchthaus und schwerer Zwangsarbeit verurteilt. Eine Flucht aus England lehnte er ab. Paradoxerweise war es nicht Wildes Verhältnis zu Douglas, das ihm zum Verhängnis wurde, sondern sein Umgang mit männlichen Prostituierten, die als Zeugen gehört worden waren. Douglas hingegen kam straffrei davon, weil eine Prüfung die Geringfügigkeit seiner sittlichen Vergehen feststellte.
Zu Beginn seiner Strafe war Oscar Wilde im Londoner Zuchthaus Wandsworth untergebracht, wurde allerdings am 20.11.1895 nach Reading überführt, wo er den Großteil seiner Strafe abbüßte. Noch im Gefängnis wurde er enteignet, weil er die Prozesskosten nicht tragen konnte und durch den Marquis von Queensberry als bankrott erklärt.
Wilde erholte sich von seiner Inhaftierung nie mehr. Seine Gesundheit hatte unter den menschenunwürdigen Bedingungen im Zuchthaus schwer gelitten. Nach seiner Entlassung 1897 traf er sich noch einmal mit Alfred Douglas. Gemeinsam verbrachten sie einige Wochen in Neapel, bis sie ihre verhängnisvolle Beziehung endgültig beendeten. Danach floh er ins Exil nach Paris und lebte dort verarmt und isoliert. Er schrieb außer „Die Ballade vom Zuchthaus zu Reading“ nichts mehr. Freunde, die ihn besuchten, beschrieben ihn als vereinsamt und niedergeschlagen. Er starb 3 Jahre später am 30.11.1900, wahrscheinlich an Syphilis, obwohl eine Theorie südafrikanischer Wissenschaftler behauptet, sein Tod sei von einer schweren Hirnhautentzündung verursacht worden. Er hatte seine Heimat Britannien nach seiner Flucht nie wieder betreten.
„De Profundis“ entstand während Wildes Zwangsaufenthalt in Reading. Er durfte ihn nicht abschicken, es wurde ihm jedoch gestattet, den Brief bei seiner Entlassung mitzunehmen. Er übergab ihn seinem Lektor, Freund und ehemaligen Liebhaber Robert Baldwin Ross, der ihn aufbewahren und eine Kopie an Alfred Douglas schicken sollte. Douglas bestritt, den Brief je erhalten zu haben. Ob das der Wahrheit entspricht, ist bis heute nicht geklärt.
Veröffentlicht wurde das Werk posthum; die erste, gekürzte Ausgabe erschien im Februar 1905 bei S. Fischer in Berlin und etwa zwei Wochen später in England. Die vollständige, korrekte Version erblickte erst 1962 das Licht der Welt, in dem Band „The Letters of Oscar Wilde“. Das Originalmanuskript wird im British Museum verwahrt.
Ich persönlich vertrete die Meinung, dass Alfred Douglas den an ihn adressierten Brief sehr wohl erhielt. Robert Ross hätte Wildes Wunsch nicht ignoriert, da bin ich sicher. Ich denke, Douglas glaubte, einfach so tun zu können, als hätte ihn „De Profundis“ nie erreicht, um sich nicht öffentlich mit dessen Inhalt auseinandersetzen zu müssen. Die Veröffentlichung des Textes machte ihm dann natürlich einen Strich durch die Rechnung. Statt demütig seine Fehler einzugestehen, teilte Douglas aus und äußerte sich oft abfällig und beleidigend über Oscar Wilde. Er gab später zu, dass seine Wut auf „De Profundis“ zurückging und bedauerte sein Benehmen. Selbstverständlich war sein Verhalten falsch, aber ich verstehe ihn. Ich verstehe, dass Douglas fuchsteufelswild war, weil die intimen Bekenntnisse seines ehemaligen Geliebten nun öffentlich zugänglich waren. Die Dinge, die Wilde schrieb… ganz ehrlich, so etwas würde ich auch nicht über mich und eine vergangene Beziehung veröffentlicht sehen wollen.
In „De Profundis“ rechnet Oscar Wilde mit seinem Verhältnis zu Alfred Douglas und seinem eigenen Leben ab. Er führt bis ins kleinste Detail auf, wann und inwiefern sich Douglas seiner Meinung nach falsch und verletzend aufführte. Er zeichnet das Bild eines Parasiten, der immer nur nahm, ohne jemals zu geben. Er schildert Szenen ihrer Beziehung, ihres gemeinsamen Lebens in allen Einzelheiten und geht hart mit Douglas ins Gericht. Tatsächlich hatte ich den Eindruck, dass Douglas keine einzige positive Eigenschaft besaß. Durch Wildes Aussagen erschien er mir extrem unsympathisch: anstrengend, melodramatisch, undankbar, egoistisch und launisch. Mir ist natürlich bewusst, dass diese Charakterbeschreibung vollkommen subjektiv ist und nur eine Seite der Realität darstellt. So eingängig und nachvollziehbar Wilde seine Gefühle wiedergibt, bleibt doch eine Frage bestehen – wieso trennte er sich nicht von Douglas, wenn ihm dessen Gesellschaft persönlich und professionell schadete?
Wilde bietet auf diese Frage eine Antwort. Er betont, dass er durchaus wiederholt versuchte, ihre Beziehung zu beenden, es aber einfach nicht schaffte. Douglas stahl sich immer wieder in sein Leben und war sich nicht zu schade, dafür die Hilfe seiner eigenen Mutter oder der Freunde und Familie seines Liebhabers in Anspruch zu nehmen. Ich gestehe, diesbezüglich fehlt mir ein wenig historisch-gesellschaftliches Kontextwissen. Ich weiß nicht, ob die gesellschaftlichen Normen Wilde zwangen, die Freundschaft weiterzuführen. Ich bin nicht sicher, ob er überhaupt eine andere Wahl hatte, sobald seine Freunde und in einem beispiellosen Fall sogar seine eigene Ehefrau ihn für seine Distanz zu Douglas schalten und ihn in dessen Namen baten, den Kontakt wiederaufzunehmen. Ich habe keine Vorstellung davon, ob er ihnen die Situation hätte erklären können oder ob es sich für damalige Verhältnisse nicht schickte, diese vertraulichen Details zu offenbaren. Ich habe wirklich keine Ahnung. Nichtsdestotrotz erschien mir das Eingeständnis seiner eigenen Willensschwäche eher fadenscheinig und nicht besonders glaubwürdig. Er mag zugegeben haben, dass er sich dem Druck von außen nicht entgegenstellen konnte, meiner Ansicht nach sah er die Schuld dafür jedoch trotzdem bei Douglas, nicht bei sich selbst. Ich glaube nicht, dass er seinen eigenen Anteil am katastrophalen Wesen ihrer Beziehung einsah. Meinem Empfinden nach sind seine harschen Anschuldigungen zu umfangreich, vorwurfsvoll und nachdrücklich; aus seinen Worten sprach zwischen den Zeilen zu viel Schmerz und Enttäuschung. Tatsächlich bin ich sogar überzeugt, dass Wilde Douglas noch immer liebte, als er „De Profundis“ schrieb.
Wie bereits erwähnt, war das Thema Finanzen zwischen Oscar Wilde und Alfred Douglas ein immerwährender Konfliktherd. Für mich war es befremdlich, Wilde in seinem Brief die Kosten seines Lebens mit seinem Liebhaber genauestens aufrechnen zu sehen. Oh ja, er nennt Zahlen, als hätte er exakt darüber Buch geführt. Ausgerechnet der Mann, der in der Öffentlichkeit den Anschein eines Dandys erwecken wollte und dieses Bild penibel pflegte, warf seinem Geliebten Verschwendung vor. Ich will nicht behaupten, dass diese Kritik ungerechtfertigt war, es war nur seltsam, dass sie jemand äußerte, dem Schönheit und Spaß im Leben stets überaus wichtig waren. Ich denke, diesbezüglich zeigt „De Profundis“ sehr deutlich, wie stark sich Oscar Wildes äußeres Image und seine wahre Persönlichkeit unterschieden. Er wollte als Luftikus erscheinen, dem kaum etwas viel bedeutete außer seinem Vergnügen, nicht einmal seine Werke. Glücklicherweise wissen wir mittlerweile, dass das nicht stimmt. Ich denke, seine bürgerliche Herkunft war in Oscar Wilde stärker verwurzelt, als er zugeben wollte. Natürlich konnte er demzufolge mit dem ausgefallenen Lebensstil des Adels, aus dem Douglas stammte, nichts anfangen und hatte kein Verständnis für dessen verschwenderische Vergnügungssucht. Teure Essen, teure Weine, Club- und Theaterbesuche – offenbar brauchte und wollte Wilde all das gar nicht in dem Maße, nach dem es Douglas verlangte. Scheinbar war er viel bescheidener, als ich bisher annahm.
Neben all den Verletzungen und Kränkungen, die Wilde durch Douglas erlitt, nahm er ihm dessen Drängen auf eine Verleumdungsklage gegen seinen Vater vermutlich am übelsten. Er sah sich als Opfer des Hasses zwischen Vater und Sohn und glaubte, von beiden Seiten in einer alten, festgefahrenen Fehde benutzt und instrumentalisiert worden zu sein. Obwohl ich ihm hier grundsätzlich zustimmen muss, weil auch ich denke, dass es bei der Provokation des Marquis und dem darauffolgenden Prozess nie um Oscar Wilde persönlich ging, hatte ich doch erneut das Gefühl, dass er seine eigene Verantwortung mehr oder weniger ignorierte. Niemand zwang ihn, den Marquis zu verklagen. Es war seine eigene Entscheidung, nicht auf den Rat seiner Freunde zu hören und sich in den Kleinkrieg zwischen Douglas und dessen Vater hineinziehen zu lassen. Er muss gewusst haben, dass er ein Risiko einging und sich das Blatt wenden könnte. Warum er sich trotzdem auf diesen Wahnsinn einließ, ist mir ein Rätsel. Vielleicht wollte er Douglas beeindrucken. Vielleicht wollte er ein Vorbild sein und seinem jüngeren Partner zeigen, was es bedeutete, für ihre Beziehung einzustehen und für einander da zu sein. Ich weiß es nicht.
Die kleinliche Abrechnung mit Douglas stellt nur den ersten Teil des Briefes dar. Der zweite Teil von „De Profundis“ ist eine Einschätzung von Wildes eigenem Leben und der verzweifelte Versuch, seiner hoffnungslosen Lage etwas Positives abgewinnen zu können. Wilde wird sehr theologisch; er philosophierte über Jesus, der seiner Meinung nach das Herz und die Seele eines Künstlers besaß. Ich fand, dass sich dieser Part sehr zäh und schleppend las. Er schwor, sein Leben zu ändern und beteuerte, dass sich seine Persönlichkeit durch die Haft bereits verändert hätte. Fest entschlossen, sich auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist, schmiedete er Pläne für die Zeit nach seiner Entlassung. Es ist tragisch, dass er diese Vorhaben nie verwirklichen konnte. Das Wissen darum, dass sich all seine guten Vorsätze spätestens in dem Moment, in dem ihm ein halbjähriger Aufenthalt als Büßer in einem Jesuitenkolleg verwehrt wurde, in Luft auflösten, gestaltete die Lektüre für mich sehr bitter. Wilde wollte sich ändern. Ich denke, seine Gelöbnisse waren definitiv ernst gemeint und kamen von Herzen, doch offenbar war die Ablehnung des Kollegleiters für ihn dermaßen niederschmetternd, dass ihn jegliche Hoffnung verließ. Meiner Ansicht nach nahm ihm diese letzte Demütigung seinen Lebenswillen. All die Erkenntnisse, die er während seiner Inhaftierung über sich selbst gewonnen hatte, der Entwicklungsprozess, den er durchlebt hatte, waren plötzlich wertlos, weil ihm nicht gestattet wurde, sie in Freiheit auszuleben. Also fiel er in alte Muster zurück, floh nach Paris und lebte dort auf Kosten des Besitzers eines billigen Hotels, bis er schließlich starb. Ich denke, er resignierte einfach, gebrochen und desillusioniert. Wer weiß, was man noch von ihm hätte erwarten können, hätte er diese 6 Monate in dem Jesuitenkolleg verbringen dürfen. Vielleicht hätte er zu seiner alten Form zurückgefunden. Es ist eine Tragödie.
Im dritten und letzten Part des Briefes kommt Wilde noch einmal auf Alfred Douglas zurück. Er berichtete von seiner Korrespondenz mit Douglas‘ Mutter, die ihn hinter dem Rücken ihres Sohnes oft bat, positiven Einfluss auf ihn zu nehmen, während sie selbst es nicht über sich brachte, seine Fehler offen anzusprechen. Wilde beschwerte sich darüber, dass Douglas‘ Mutter ihre Verantwortung unter dem Mantel der Verschwiegenheit an ihn abzugeben versuchte. Betrachtet man Douglas‘ Eltern, wird schnell klar, warum seine Persönlichkeit so viele negative Züge aufwies. Sein Vater war abwesend, dominant und aggressiv; seine Mutter nicht fähig oder nicht willens, ihrem Sohn Grenzen aufzuweisen. Er hatte zwei ältere Brüder, von denen nur einer eine gewisse Vorbildfunktion hätte erfüllen können. Soweit ich das sehe, hätte die ganze Familie in psychotherapeutische Behandlung gehört. Der junge Alfred Douglas konnte gar nicht lernen, ein guter Mensch zu sein, weil es ihm niemand beibrachte. An Wildes Stelle hätte ich von Anfang an einen großen Bogen um diesen Mann gemacht. Tja, aber wie sagt man so schön? Das Herz will, was das Herz will. Am Ende von „De Profundis“ forderte Wilde seinen Liebsten auf, sein Leben und ihre Beziehung objektiv zu betrachten und sich in ihn hineinzuversetzen. Ich denke nicht, dass Douglas dazu in der Lage war. Später vielleicht, aber nicht im Alter von 27 Jahren. Er hatte es ja noch nicht einmal fertiggebracht, Wilde während seiner Inhaftierung auch nur ein einziges Mal zu schreiben. Die Enttäuschung darüber äußerte Wilde wiederholt, konnte ganz zum Schluss allerdings nicht aus seiner Haut. Mit den letzten Worten seines Briefes öffnete er Douglas doch noch einmal seine Tür. Er schien zu glauben, dass zwischen ihnen noch nicht alles verloren sei. Meinem Empfinden nach vermisste Wilde Douglas weit mehr, als er eingestehen wollte. Vielleicht ist das die größte Tragödie ihrer geteilten Geschichte: trotz des fatalen Verlaufs ihrer Beziehung konnte er nie von Douglas lassen. Möglicherweise konnte er ihn bis zu seinem Lebensende nicht loslassen, obwohl er ihre Verbindung nach seiner Entlassung endgültig trennte.
Ich weiß nicht, was in ihren letzten gemeinsamen Wochen in Neapel vorgefallen ist, doch ich habe den Eindruck, dass die Trennung eine rein vernunftbasierte Entscheidung seitens Wilde war, weil er wusste, dass Douglas ihm nicht guttat. Ich denke jedoch, dass er nie aufhörte, ihn zu lieben. Die Umstände seiner letzten Lebensjahre, die resignierte Einsamkeit, die ihn gefangen hielt, erscheinen mir die direkten Folgen eines gebrochenen Herzens zu sein. Ach, ist das alles traurig. Vielleicht interpretiere ich zu viel in diese Geschichte hinein, das will ich nicht ausschließen, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass Alfred Douglas trotz all des Kummers, den er ihm bereitete, Oscar Wildes große Liebe war.
Zusammenfassend lässt sich wohl getrost behaupten, dass die Beziehung zwischen Oscar Wilde und Lord Alfred Bruce Douglas eine verhängnisvolle Liebschaft war. Der Autor hätte sich niemals auf den viel jüngeren, unsteten Mann einlassen dürfen. Dieses Verhältnis zerstörte buchstäblich sein Leben. Ich schreibe absichtlich „Verhältnis“ und schiebe den schwarzen Peter nicht Douglas zu, weil ich fest davon überzeugt bin, dass zu einer fatalen Beziehung immer zwei gehören. Natürlich ist der negative Einfluss des exzentrischen Adligen nicht zu leugnen, schreibt Wilde doch, dass er in Anwesenheit desselben nicht in der Lage war, seiner Arbeit nachzugehen, aber Wilde war derjenige, der diesen negativen Einfluss zuließ. Er war älter, er war reifer, er hätte erwachsen genug sein müssen, um die unkontrollierbaren Auswüchse ihrer Beziehung zu erkennen und entsprechend zu handeln. Ich weiß nicht, ob er es nicht konnte oder schlicht nicht wollte. Es fällt mir jedenfalls schwer zu glauben, dass Wilde keine Möglichkeit hatte, ihre toxische Verbindung zu lösen. Ich kann ihn von seiner Verantwortung nicht freisprechen. Trotz dessen hätte ich mir natürlich ein anderes Ende für den unvergleichlichen Autor gewünscht. Er hatte ein Happy End verdient.
„De Profundis“ hat mein Verständnis meines Lieblingsautors deutlich vertieft. Ich habe begriffen, dass sich hinter all den Vergnügungen, dem scharfen, ironischen Witz und der unleugbaren Arroganz ein empfindsamer, verletzlicher und ernsthafter Mann verbarg, der erstaunlich bodenständige Vorstellungen vom Leben hatte. Er wollte als der akzeptiert werden, der er war, trotz all seiner öffentlichen Exzentrik. Das Schreiben war sein Leben. Seine Hingabe zur Kunst war mindestens ebenso stark wie seine Gefühle für Lord Alfred Bruce Douglas. Es ist so schade, dass ihn seine Zeit im Zuchthaus für immer von seiner Muse trennte und er dadurch nicht mehr Werke erschaffen konnte, die die Menschen bis heute bewegen. Er ist definitiv zu früh gestorben. Obwohl er mir da vielleicht widersprechen würde. Schließlich lauteten seine angeblichen letzten Worte „Entweder geht diese scheußliche Tapete – oder ich“.



 Log in with Facebook
Log in with Facebook