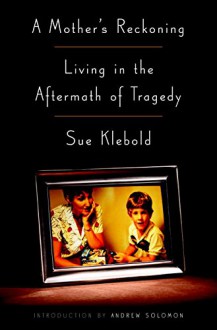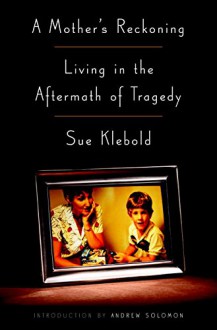
Am 20. April 1999 um 11:19 Uhr betraten Eric David Harris und Dylan Bennet Klebold die Columbine High-School in Colorado durch den Westeingang und eröffneten das Feuer. Sie trugen je zwei Schusswaffen, schwarze Trenchcoats, schwarze Hosen und eigens für den Anlass bedruckte T-Shirts. Erics Brust zierte der Schriftzug „Natural Selection“; auf Dylans Shirt prangte das Wort „Wrath“. Innerhalb einer knappen Stunde warfen sie selbstgebastelte Rohrbomben sowie Molotowcocktails und verschossen wahllos insgesamt 188 Kugeln. Sie töteten 12 Schüler_innen und einen Lehrer. 21 Menschen wurden zum Teil schwer verwundet. Kurz nach 12 Uhr begingen Eric und Dylan in der Bibliothek ihrer Schule Selbstmord. Ihr Amoklauf war als Bombenanschlag geplant. Die in der Cafeteria deponierten, selbstgebauten Sprengsätze explodierten aufgrund eines technischen Fehlers nicht.
125 Worte. Ich brauchte 125 Worte, um eines der schlimmsten Schulmassaker in der US-amerikanischen Geschichte zusammenzufassen. Schockierend, wie wenig die Fakten dieser Tragödie verlangen.
Der Amoklauf an der Columbine High-School war nicht die erste Schulschießerei, die das Land erlebt hatte. Es war jedoch die erste Schulschießerei, die globales Aufsehen und Medieninteresse, sowie eine hitzige Debatte über Mobbing, Ego-Shooter, gewaltverherrlichende Musik und das Waffenrecht auslöste. Das Massaker hatte weitreichende Konsequenzen. Nicht zuletzt wird der nachfolgende Anstieg von Amokläufen an Schulen „Columbine Effekt“ genannt, weil viele Täter_innen angaben, von Eric Harris und Dylan Klebold inspiriert worden zu sein. Die Generation, die nach dem 20. April 1999 in den USA geboren wurde, wird als „Generation Columbine“ betitelt – Kids, die eine Welt ohne Schulschießereien gar nicht kennen. Columbine ist die Mutter aller Schulmassaker.
Als Eric Harris und Dylan Klebold ein beispielloses Blutbad anrichteten, war ich 8 Jahre alt. Ich erinnere mich nicht daran, dass die Vorfälle in Colorado in irgendeiner Form in meinem Leben thematisiert wurden und auch meine Eltern konnten auf meine Nachfrage hin keine Situation rekonstruieren, in der wir darüber gesprochen hätten. Columbine rückte erst sehr viel später ins Zentrum meiner Aufmerksamkeit: ich begann, mich mit Schul-Amokläufen im Allgemeinen auseinanderzusetzen, um zu verstehen, was die Täter_innen bewegte und wie es möglich war, dass ihr Schmerz und ihre Verzweiflung teilweise jahrelang unbemerkt blieben.
Als ich entdeckte, dass Dylans Mutter Sue Klebold 2016 ein Buch veröffentlicht hatte, das den Titel „A Mother’s Reckoning: Living in the Aftermath of the Columbine Tragedy“ trug, stand für mich sofort fest, dass ich es kaufen und lesen wollte. Meine Motivation war sehr simpel. Ich wollte es begreifen. Ich wollte begreifen, wie man so etwas überlebt.
Die Lektüre im April 2018, nur wenige Tage nach dem 19. Jahrestag des Massakers, gestaltete sich ungemein aufwühlend, emotional und erschütternd. Ich fühlte mich danach wie betäubt, weil ich nicht fähig war, all den widerstreitenden Gefühlen in meinem Herzen und den konfusen Gedanken in meinem Kopf Herrin zu werden.
Ich stelle mir mein Bücherhirn gern als Raum voller metallener Aktenschränke vor. Reihe um Reihe. Eine Schublade für jedes Buch. Normalerweise herrscht hier strikte, penible Ordnung. Bereite ich mich mental auf eine Rezension vor, betrete ich den Raum und öffne die entsprechende Schublade. Nur diese. Mehrere Schubladen auf einmal zu öffnen, ist streng verboten. Meine Gedanken zu einem bestimmten Buch fliegen mir Stück für Stück aus der offenen Schublade zu, mal mehr, mal weniger stetig. So ist es mir möglich, hunderte Bücher auseinanderzuhalten und mich teilweise nach Jahren an sie zu erinnern, als hätte ich sie erst gestern ausgelesen. Nach „A Mother’s Reckoning“ war das Bücher-Akten-Zimmer in meinem Kopf ein Katastrophenschauplatz. Es sah darin aus, als wäre ein Hurricane durchgejagt, gefolgt von einem verheerenden Erdbeben und heftigen Gewittern. Alle Schubladen standen offen, lose Notizzettel verteilten sich überall im Raum, die Lampe hing schief, schwang mit einem leisen Quietschen hin und her und alles war triefend nass. Und in der Mitte, unangetastet und unversehrt, „A Mother’s Reckoning“. Dieses Bild, das ich sehr lebhaft vor meinem inneren Auge sah, sollte euch einen Eindruck davon vermitteln, wie ich die Lektüre erlebte. Schon während des Lesens musste ich mich immer und immer wieder daran erinnern, dass ich dort keine fiktive Geschichte vor mir ausgebreitet sah. Das war echt. Das ist wirklich passiert. All das Leid, all der Schmerz, all die Trauer, der Zorn, die Ohnmacht – Realität. Realität im Leben von Sue Klebold und im Leben der Opfer und Hinterbliebenen. Ich kämpfe mit den Tränen.
Wie so oft im Genre der Non-Fiction kann ich euch heute daher keine gewöhnliche Rezension anbieten und verzichte wieder einmal auf eine Sterne-Bewertung. Ich kann „A Mother’s Reckoning“ nicht bewerten. Selbst wenn ich wollte, ich kann es nicht. Ich kann das blutende Herz einer liebenden und trauernden Mutter nicht beurteilen. Was für ein Mensch wäre ich, wenn ich es könnte? Dieser Text, den wir behelfshalber „Rezension“ nennen wollen, ist für mich eher die Auf- und Verarbeitung meiner Emotionen, als eine tatsächliche Besprechung. Ich lade euch ein, mir Gesellschaft zu leisten. Wühlen wir uns gemeinsam durch das Chaos und versuchen, sinnvolle Gedanken herauszufiltern.
Dylan Bennett Klebold wurde am 11. September 1981 geboren. Er war ein normales, aber überdurchschnittlich intelligentes Kind. Er besuchte ein Programm für hochbegabte Kinder, brach diese Form der Förderung jedoch aus eigenem Antrieb ab. Dylan lernte Eric Harris 1993 auf der Middle School kennen; dank gemeinsamer Interessen freundeten sie sich schnell an. Ab 1995 gingen beide auf die Columbine High-School. Dort rangierten sie zwar am unteren Ende der sozialen Hackordnung, waren jedoch keineswegs Außenseiter. Sie stammten beide aus fürsorglichen, liebenden Elternhäusern und hatten einen stabilen Freundeskreis. Niemand ahnte, dass Dylan und Eric fähig waren, 13 Menschen zu ermorden, 21 weitere zu verletzen und sich am Ende selbst zu erschießen.
„A Mother’s Reckoning“ beginnt am 20. April 1999, um 12:05 Uhr. Susan „Sue“ Klebold schildert, dass sie einen ganz normalen Tag im Büro verbrachte, bis sie eine Nachricht auf ihrer Mailbox abhörte. Die Nachricht ihres Ehemannes Tom, die ihr Leben für immer veränderte, in der er ihr aufgeregt von einem Notfall berichtete und sie aufforderte, ihn sofort zurückzurufen. Er war es, der sie beim anschließenden Telefonat über die Schüsse in der Columbine High-School informierte. Sie beschreibt den Verlauf des weiteren Tages: die Ängste, die sie ausstand, weil sie glaubte, Dylan sei tot, angeschossen oder werde als Geisel gehalten. Die Erinnerungen an einen ungewöhnlich kurzen, harschen Wortwechsel mit Dylan am frühen Morgen. Die Erkenntnis, dass Dylan in die Schießerei verwickelt war, dass er aktiv daran beteiligt war, Menschen zu töten und zu verletzten. Und gegen Abend die schrecklich erleichternde Bestätigung, dass Dylan tot war.
„A Mother’s Reckoning“ ist keine Entschuldigung. Es ist keine Rechtfertigung und kein egozentrisches Manifest. Das Buch enthält keinerlei Ausflüchte, Ausreden oder lahme Unschuldsbeteuerungen. Sue Klebold bettelt nicht um Absolution. Es ist eine Chronik des Kampfes, den sie seit fast 20 Jahren austrägt und der Versuch einer Erklärung. Das Buch dient darüber hinaus sicherlich der Verarbeitung ihrer Erinnerungen und meiner Ansicht nach versucht sie durchaus, das öffentliche Bild ihres Sohnes vor seinen Verbrechen zu korrigieren. Vor allem ist es jedoch eine verzweifelte Warnung.
Sue porträtiert Dylan, den Dylan, den sie kannte und großgezogen hatte, als einen guten Jungen. Ein Junge, um den man sich keine Sorgen machen musste. Er war klug, sensibel, zuverlässig und höflich. Sie hätte ihn niemals als Außenseiter bezeichnet, denn seit seiner Kindheit gingen seine Freunde in ihrem Haus ein und aus, aßen mit der Familie und blieben hin und wieder über Nacht. Dylan hatte Pläne, er wollte Informatik studieren und hatte sich kurz vor dem Massaker in Begleitung seiner Eltern den Campus eines Colleges angesehen, an dem er akzeptiert worden war. Nichts deutete auf die Abgründe in seiner Seele hin. Nicht einmal seine Freundschaft mit Eric.
Sue und Tom kannten Eric. Sie wussten, dass er nicht den besten Einfluss auf ihren Sohn hatte. Gemeinsam hatten sie in mehrere Schulspinde geöffnet und wurden suspendiert. Später brachen sie in einen Van ein und stahlen Elektrogeräte. Sie wurden erwischt und mussten an einem Programm für jugendliche Straftäter teilnehmen. Doch diese Vorkommnisse lagen zum Zeitpunkt des Amoklaufs Monate zurück. Die Klebolds glaubten, Dylan habe sich gefangen, seine Lektion gelernt. Sie unterbanden Dylans Kontakt mit Eric nicht, weil sie auch ihn für einen guten Jungen hielten. Sue spricht in „A Mother’s Reckoning“ nicht ein einziges Mal schlecht über Eric. Ich fand das bemerkenswert. Es wäre leicht gewesen, die Schuld am Massaker auf ihn abzuwälzen. Stattdessen zählt sie nur Fakten und Expertenmeinungen auf und betont, dass sie das Ausmaß seines negativen Einflusses auf Dylan nicht erkannte. Ebenso wenig, wie sie den Jungen mit dem Gesicht ihres Sohnes erkannte, der am 20. April 1999 Menschen ermordete und verletzte.
Ich hatte vor der Lektüre des Buches tatsächlich ein völlig anderes Bild von Dylan Klebold. Ich habe ihn für einen Außenseiter ohne soziales Netz gehalten, dessen einziger Freund ein Junge war, der dem Leben dieselbe Enttäuschung und Wut entgegenbrachte, die er selbst empfand. Ich dachte, sie wären eine Zwei-Mann-Armee gegen den Rest der Welt gewesen. Es überraschte mich, wie gut sie in die Gesellschaft ihres kleinen Städtchens eingebunden waren: Freunde, Familie, sogar Jobs bei einem lokalen Pizzalieferanten. Dylan besuchte drei Tage vor dem Massaker mit einer Freundin die Prom seiner Schule. Sie waren weder unbeliebt, noch mussten sie in gewalttätigen Elternhäusern aufwachsen. Ich habe nie über die Familien der beiden nachgedacht, was mir nun ein wenig paradox erscheint, mir aber ermöglichte, völlig offen in Sue Klebolds Schilderungen hineinzugehen. Ich hatte keine vorgefasste Meinung von Sue, ich hatte eine vorgefasste Meinung von Dylan und Eric. Nach den Eindrücken, die Sue mit mir teilte und die diese Vorurteile korrigierten, hätte ich niemals angenommen, dass die beiden so viel Hass in ihren Herzen trugen. Ich hätte sie für ganz normale Jungs gehalten. Sie selbst nahmen sich tragischerweise vollkommen anders wahr. Sie hielten sich wirklich für eine Zwei-Mann-Armee.
Dylan Klebold war depressiv und suizidgefährdet. Vermutlich litt er an einer angeborenen psychischen Störung, eventuell Borderline, obwohl es unmöglich ist, im Nachhinein eine definite Diagnose zu stellen. Seine Tagebucheinträge zeichnen das Bild eines zutiefst kummervollen, lebensmüden, verlorenen jungen Mannes, der sich unverstanden und isoliert fühlte. Dylan sehnte sich nach Liebe. Einige Zeilen deuten darauf hin, dass er unglücklich verliebt war. Es wäre jedoch falsch, anzunehmen, Dylan habe die reine Seele eines Poeten in sich getragen und sei zufällig in das Massaker hineingezogen worden. In den berüchtigten Basement Tapes zeigt er eine andere Seite seiner komplexen Persönlichkeit: Hass. Zorn. Verachtung. Heftige Empfindungen, deren Ursprung nicht einmal seine Mutter schlüssig erklären kann. Dylan und Eric wurden laut Zeugenaussagen in der Schule gemobbt; Tom zufolge äußerte Dylan ihm gegenüber jedoch, dass er mit einer Körpergröße von 1,90m keine Probleme mit Schikanen habe. Eric hingegen werde regelmäßig drangsaliert. Dylans negative Gefühle richteten sich nicht gegen seine Familie. In einem der selbstgedrehten Videos schlägt Eric vor, dass sie beide einige Worte über ihre Familien äußern. Dylan weigert sich. Er sagt „Meine Eltern waren gut zu mir. Ich möchte darüber nicht sprechen“. Er hasste die Welt, doch seine Familie hasste er nicht.
Einige Experten, mit denen Sue Klebold lange nach der Tat sprach und die sie zitiert, glauben, dass Dylans Beteiligung am Columbine-Massaker primär nicht dadurch motiviert war, andere Menschen töten zu wollen. In erster Linie wollte er sich selbst töten. Dylan wollte sterben und es war ihm egal, ob andere dabei ebenfalls starben. Eric hingegen, dem basierend auf seinen Tagebucheinträgen nachträglich psychopathische Charakterzüge attestiert wurden, wollte töten und es war ihm egal, ob er dabei selbst getötet wurde.
Dylan Klebold war krank. Diese Tatsache ist in keiner Weise eine Legitimation für seine Entscheidung, einen Amoklauf zu planen, durchzuführen und wahllos das Leben vieler Menschen zu zerstören (nicht zuletzt das Leben seiner eigenen Familie), aber sie ist unumgänglich, will man verstehen, wie Dylan die Grenzen des Fassbaren so weit hinter sich lassen konnte und wieso seine Mutter Sue Klebold dieses Buch schrieb.
Jugendliche sind eine Risikogruppe für Depressionen. Im Vergleich zu Erwachsenen sind sie deutlich anfälliger und ihre Symptome bleiben häufig unerkannt, weil sie mit dem Totschlagargument „Pubertät“ abgetan werden. Sie sind äußerst talentiert darin, ihren wahren Gemütszustand zu verbergen. Geheimnisse gehören zu diesem Lebensabschnitt ja beinahe dazu. Dylan ist ein trauriges Beispiel dafür, wie weit diese Scharade führen kann. Niemand vermutete, wie es tatsächlich in ihm aussah. Natürlich gab es Augenblicke, in denen Sue und Tom Klebold ihren jüngeren Sohn mit Sorge betrachteten. Er war reizbar und manchmal in sich gekehrt – welcher Teenager ist das nicht? Aber sein Verhalten änderte sich niemals so drastisch, dass sie ihn nicht wiedererkannt oder ernsthaft in Betracht gezogen hätten, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Dylan lebte an einem sehr finsteren Ort und verbarg es erfolgreich vor allen. Er muss schrecklich einsam gewesen sein.
All die Dinge, die Sue Klebold nachträglich über ihren geliebten Sohn erfuhr, brachen ihr Herz. Wieder und wieder. Jeden Tag aufs Neue. Man muss sich vergegenwärtigen, dass die Mutter eines Amokläufers (oder, seltener, einer Amokläuferin) eben an erster Stelle genau das ist: eine Mutter. Wie reagiert eine Mutter darauf, dass das Kind, das sie gebar, fütterte, badete, versorgte, lehrte, tröstete und bedingungslos liebte, nicht die Person ist, für die sie es gehalten hat? Wie reagiert sie, wenn dieses Kind bewusst entscheidet, zu verletzten, zu zerstören und das Leben, das sie ihm schenkte, zu beenden? Liebe endet nicht mit einem Knall. Wäre der verständliche Impuls nicht, sich noch immer schützend vor dieses Kind zu stellen, es zu verteidigen, seine Taten zu rechtfertigen?
Sue Klebold entschuldigt Dylans Rolle im Columbine-Massaker niemals. Auf jeder Seite in „A Mother’s Reckoning“ ist deutlich, dass sie ihren Sohn voll verantwortlich sieht für das, was er getan hat. Dylan war ein Mörder. Kein Argument kann diesen Fakt relativieren oder entschärfen. Sue verschließt sich dieser bitteren Wahrheit nicht. Sie stellt sich ihr – für sich, für ihre Familie, für Dylans Opfer und ihre Angehörigen, denen gegenüber sie sich meiner externen Ansicht nach unglaublich respektvoll verhält. Ich möchte mir allerdings nicht anmaßen, die Wirkung von „A Mother’s Reckoning“ für jemanden, der/die die Konsequenzen des Columbine-Massakers selbst erfuhr, zu beurteilen. Das steht mir nicht zu.
Sue musste einen langen, steinigen Weg zurücklegen, bis sie fähig war, die Vorstellung von Dylan als Mörder zu akzeptieren. Sie brauchte Jahre, um zu verinnerlichen, dass Dylan ein emotionales Doppelleben geführt und sein gesamtes Umfeld grundsätzlich belogen hatte. Ihr Trauerprozess ist noch lange nicht abgeschlossen, vielleicht wird er es nie sein. Sie wirkt in „A Mother’s Reckoning“ gefasst, doch das bedeutet nicht, dass sie nicht länger trauern würde. Vielmehr scheint sie vor der Trauer als ihrem ständigen Begleiter resigniert zu haben. Seit beinahe 20 Jahren quälen sie vor allem zwei Fragen: „Wie konntest du das nur tun?“ und „Was habe ich falsch gemacht?“. Sues Trauer ist hochgradig komplex, weil Dylans Taten ihr die Möglichkeit nahmen, ohne Schuldgefühle um ihren verstorbenen Sohn zu weinen. Sie ist mehr als die Mutter eines Selbstmörders. Sie ist die Mutter eines Mörder-Selbstmörders. Sue musste erst lernen, dass sie ein Recht dazu hat, Dylan zu betrauern. Seine grausamen, hasserfüllten Verbrechen sind nicht die ihren. Noch immer versucht sie, den brutalen Verlust ihres Sohnes, ihres Sonnenscheins, zu verkraften. Parallel muss sie den Verlust der Person, die sie für ihren Sohn hielt und die Trauer um die Familien, die er zerstörte, verarbeiten. Das Trauma, unter dem sie leidet, füllt ihre gesamte Existenz und raubte ihr ihre Identität. Sie erkrankte an Brustkrebs und einer Angststörung. Ihre Ehe ging in die Brüche. Sie trug jahrelang Gerichtsprozesse aus. Die Anfeindungen, die ihr entgegenschlugen, zermürbten ihr Selbstwertgefühl, das durch Selbstvorwürfe ohnehin bröckelte. Dylans Beteiligung am Columbine-Massaker nahm seiner Mutter alles.
Erst die analytische Auseinandersetzung mit der Tat ihres Sohnes erlaubte Sue Klebold, die Scherben ihres Lebens zusammenzukehren. Sie las viel über psychische Erkrankungen bei Jugendlichen und saugte fieberhaft jede wissenschaftliche Erkenntnis zu Selbstmördern und Amokläufern auf. Jahrelang widmete sie sich der Mission, herauszufinden, was sie übersehen hatte und wie sie das Schicksal, das ihre Familie durchleiden musste, anderen Familien ersparen könnte. Sie begann zu begreifen, dass aus den zahllosen Beschuldigungen und aus ihrer gesellschaftlichen Stigmatisierung Furcht sprach. Die Menschen fragten sie, wie sie nicht realisieren konnte, was unter ihrem Dach vor sich ging. Sie fragten, wie ihr Dylans seelische Abgründe entgehen konnten. Sie fragten, wie sie unbemerkt ein Monster großziehen konnte. Sie forderten Erklärungen von ihr, die sie lange Zeit nicht liefern konnte. Sie wusste nicht, was sie falsch gemacht hatte. Dylan war nie ignoriert, nie vernachlässigt, nie geschlagen, nie misshandelt worden. Wie sollte sie diesen Menschen, diesen Fremden, erläutern, was sie selbst nicht begriff?
Sues Unfähigkeit, Dylans schreckliche Verbrechen nachvollziehbar zu erklären, provozierte Wut. Ihr schlug eine Welle des Hasses entgegen, die sie erst Jahre später korrekt zu deuten lernte. Die Menschen hatten Angst. Sie wollten Dylan so weit von sich schieben wie nur irgend möglich. Sie wollten ihn als Anomalie kategorisieren, die nichts mit ihnen und ihren Leben zu tun hatte. Sie wollten die Illusion aufrechterhalten, dass das Böse erkennbar ist. Sues Beteuerungen, dass Dylan ihren Erinnerungen zufolge ein ganz normaler Junge war, bedrohte diese Weltanschauung. Wenn ein freundlicher, höflicher Junge aus einer durchschnittlichen US-amerikanischen Nachbarschaft fähig war, ein Blutbad anzurichten, wer versicherte ihnen dann, dass nicht auch andere freundliche, höfliche Jungs aus durchschnittlichen US-amerikanischen Nachbarschaften zur Waffe greifen könnten? Wer beruhigte sie, dass ihre Kinder keine geheimen Gewaltfantasien hegten? Wer bewahrte sie davor, einsehen zu müssen, dass die Tragödie der Klebolds jede Familie ereilen könnte?
Die Erkenntnis, dass die Kritik an ihrer Person und ihrer Familie aus dem Bedürfnis nach Abgrenzung und Distanz entsprang, veränderte Sue Klebolds Leben. Sie begriff, dass ihr Kampf nicht der Reinwaschung ihres Namens gelten durfte. Es spielte keine Rolle, wie oft sie angegriffen wurde. Ihr Kampf musste sich gegen Dylans Krankheit richten, die so viele junge Leben qualvoll bestimmt. Solange Depressionen bei Jugendlichen häufig unerkannt bleiben, kann es weitere Fälle wie das Columbine-Massaker geben. Weitere Selbstmorde. Weitere Amokläufe. Weitere zerstörte Familien. Sue begann, sich aufopferungsvoll in der Suizidprävention zu betätigen. Meiner Meinung nach rettete ihr dieses Engagement das Leben. Plötzlich hatte es wieder einen Sinn, ohne den sie eine leere Hülle geblieben wäre. Sie erschuf sich eine neue Identität. Es gelang ihr, die Tragödie ihres Lebens in positive Energie zu verwandeln und mit ihrer Geschichte anderen Menschen zu helfen. Sie setzte sich mit ihren Schuldgefühlen und Selbstvorwürfen auseinander und ist heutzutage fähig, sich einzugestehen, dass sie nicht einmal vermutete, was Dylan plante und ihr zum damaligen Zeitpunkt schlicht das Wissen fehlte, um zu erkennen, was in ihm vorging. Ja, sie trägt Verantwortung für das Columbine-Massaker. Aber die Schuld, die sie auf ihre Schultern lud, besteht nicht darin, dass sie keine gute Mutter gewesen wäre. Weder sie noch ihr Ehemann Tom begingen schwerwiegende, entscheidende Fehler in Dylans Erziehung. Sie liebten Dylan. Manchmal ist Liebe nicht genug. Ihre Schuld besteht darin, dass sie unwissend war. Hätte sie vor dem 20. April 1999 gewusst, was sie heute weiß, hätte Columbine vielleicht verhindert werden können. 15 Menschen wären vielleicht noch am Leben.
Ihr Kampf in der Selbstmordprävention ist der Grund, warum Sue Klebold „A Mother’s Reckoning“ schrieb. Sie nutzt ihre traurige Popularität, um aufzuklären, aufzurütteln und zu sensibilisieren. Dieses Buch ist eine eindringliche Warnung, die anderen Familien all das Leid, das Dylan verursachte, im doppelten Sinne ersparen soll. Dylan war ein Opfer seiner Krankheit und ein Täter durch seine Krankheit. Hätte er nicht unter Depressionen und Suizidgedanken gelitten, hätte er sich Experten zufolge vermutlich niemals auf diesen Feldzug der Zerstörung eingelassen. Das Columbine-Massaker war eine Eskalation seiner düsteren, verzweifelten Gefühle, die hätte aufgehalten werden können.
Die Distanz, die sich viele vorgaukeln, um sich nicht damit beschäftigen zu müssen, dass sie ihr Kind vielleicht weniger gut kennen, als sie glauben, kann Leben kosten. Es ist wichtig, zu verstehen, dass es jeden treffen kann. Dylan war kein Einzelfall.
Vor diesem Hintergrund übt Sue Klebold harsche Kritik an der Presse. Die explizite Berichterstattung über den Amoklauf war respektlos, unsensibel und gefährdend. Columbine war nach O.J. Simpsons Verfolgungsjagd im Jahr 1994 (dazu in einer späteren Rezension mehr) das meistgesehene Fernsehereignis der 90er Jahre. Es ist erwiesen, dass die Ausstrahlung von Videoaufnahmen der Tat, Live-Aufnahmen des Tatorts, die Veröffentlichung von Notrufen und die Verbreitung zahlreicher Falschinformationen potentielle Nachahmungstäter_innen geradezu einluden, Dylan Klebold und Eric Harris als Vorbilder zu betrachten. Sie erlangten einen fragwürdigen Status, der an Filmstars erinnerte. Sie schafften es sogar auf das Cover des Time-Magazine. Sue Klebold betont, dass es möglich ist, die mediale Berichterstattung rücksichtsvoll und reguliert zu gestalten und verweist auf Richtlinien der Regierung.
Natürlich kritisiert sie in „A Mother’s Reckoning“ darüber hinaus das geltende Waffenrecht in den USA. Die statistischen Zusammenhänge zwischen der Verfügbarkeit von Waffen und dem Risiko von Selbstmorden und Morden sind hinlänglich bekannt. Je einfacher es ist, eine Waffe zu erwerben, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Waffe für ein Gewaltverbrechen eingesetzt wird. Dylan und Eric hatten keinerlei Schwierigkeiten, sich Waffen zu besorgen.
11 Tage nach dem Columbine-Massaker fand in Denver die nationale Jahresversammlung der NRA statt – der National Rifle Association. 8.000 Menschen demonstrierten vor dem Gebäude gegen Schusswaffen. Tom Mauser, Vater des 15-jährigen Daniel Mauser, der in der Bibliothek der Columbine High-School von Eric Harris erschossen wurde, nahm an der Demonstration teil und trug ein Schild bei sich, auf dem stand „My son Daniel died at Columbine. He’d expect me to be here today”. Der damalige Präsident der NRA zeigte sich daraufhin enttäuscht, weil die Demonstrant_innen der Waffen-Lobby ungerechtfertigt eine Mitschuld an dem Massaker unterstellten. Landesweit wurden mehr als 800 Gesetzesentwürfe eingebracht, die das herrschende Waffenrecht verschärfen sollten. Etwa 80 dieser Entwürfe waren erfolgreich. Auf Bundesebene scheiterten alle Entwürfe im Kongress.
Als Deutsche fällt es mir schwer, die Beziehung der US-Amerikaner zu Waffen nachzuvollziehen. Ich weiß um ihre historische Bedeutung. Trotzdem bleibt der Fakt bestehen, dass eine Schusswaffe einen Menschen befähigt, einen anderen Menschen mit der Krümmung eines einzigen Fingers zu töten. Das ist falsch. Schusswaffen gehören verboten. Weltweit.
Ich glaube, „A Mother’s Reckoning“ ist das emotional anspruchsvollste Buch meines bisherigen Lebens. Ich wusste selbstverständlich vor der Lektüre, dass es kein Spaziergang werden würde. Ich habe jedoch unterschätzt, wie mühelos es Sue Klebold gelang, mich zu erreichen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass dieses Buch meine schützenden Mauern überwinden könnte, die ich bei der Auseinandersetzung mit Amokläufen grundsätzlich intakt halte. Ich habe geweint, als ich las, wie Sue vor dem Kreideumriss in der Bibliothek der Columbine High-School stand, der den Ort markierte, an dem sich Dylan erschossen hatte. Ich hatte Gänsehaut, als sie beschrieb, wie sie am Abend des Massakers, nachdem klar war, dass die Zahl der Todesopfer im zweistelligen Bereich lag, für den Tod ihres Sohnes betete. Sie liebte Dylan, aber sie wusste auch, dass seine einzige Aussicht auf Gnade der Tod barg. Ihre Schilderungen waren erschütternd nahbar. Ich hatte das Gefühl, mit ihr am Küchentisch zu sitzen, weil sie tatsächlich auf jede noch so absurde, pietätlose Frage eingeht, die den Leser_innen durch den Kopf gehen könnte. Ich bin ihr so dankbar, dass sie mich an ihrem Überlebenskampf teilhaben ließ, dass ich ihr gern etwas zurückgeben möchte.
Dylan hatte sicher viele Gründe, sich niemandem mitzuteilen und all seinen Kummer zu verbergen. Alle, die Sue nennt, sind plausibel, fundiert und schlüssig. Doch ich glaube, es gab einen weiteren Grund, den sie nicht erwähnte und der ihr vielleicht nicht einmal bewusst ist, weil sie selbst nie ein Teenager mit Depressionen war. Ich hingegen schon.
Gegen Ende meiner Schulzeit bin ich ebenfalls an Depressionen erkrankt, litt unter selbstverletzendem Verhalten und hatte Suizidgedanken. Ich versuche, damit sehr offen umzugehen, weil ich mir genau wie Sue wünsche, dass psychische Krankheiten und Störungen ihr soziales Stigma verlieren. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie Dylan sich gefühlt hat. Im Gegensatz zu ihm suchte ich mir jedoch Hilfe. Erst sprach ich mit Freunden, die glücklicherweise aufmerksam genug waren, sich zu fragen, warum ich eine meiner Abiturklausuren bei 30 Grad Außentemperatur in einem langärmeligen Shirt schrieb. Später machte ich dann eine Therapie. Die Therapie… ich will nicht sagen, dass sie mein Leben rettete, denn diese Ehre gebührt meiner Hündin. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, sie im Stich zu lassen. Sie hätte nicht verstanden, warum ich eines Tages einfach nicht mehr nach Hause gekommen wäre. Für mich fühlte sich die Therapie an, als wäre ich hingefallen und hätte wieder laufen gelernt. Meine Therapeutin gab mir das Handwerkszeug, die Strategien, um wieder allein einen Fuß vor den anderen setzen zu können. Ich greife bis heute auf diese Strategien zurück und ich bin dankbar für diese Erfahrung, weil sie mich zu einem reflektierten Menschen werden ließ.
Auch ich habe meinen Eltern verschwiegen, wie ich mich fühlte. Genau wie Dylan. Ich habe ihnen erst davon erzählt, als ich die Therapie längst begonnen hatte und es mir besser ging. Ich hatte Angst, mit ihnen zu sprechen, weil ich fürchtete, dass sie sich Vorwürfe machen. Ich gab ihnen keine Schuld an meiner Situation und ich wollte nicht, dass sie es selbst tun, weil ich sie liebe. Angesichts dessen, wie wohlwollend sich Dylan über seine Familie selbst tief in seiner Depression äußerte, bin ich überzeugt, dass es ihm genau wie mir erging. Dylan wollte nicht, dass Sue und Tom dachten, seine emotionale Lage sei ihre Schuld. Aus meiner Sicht ist das ein tragischer Liebesbeweis. Er liebte sie. Deshalb sprach er nicht über seine Probleme. Natürlich ist das dumm, das weiß ich nun im Nachhinein auch. Eltern nehmen lieber die Selbstvorwürfe in Kauf, als nicht zu wissen, wie es in ihren Kindern aussieht. In Dylans Fall hatte sein Schweigen horrende Konsequenzen. Er hätte den Mund aufmachen sollen, das steht außer Zweifel. Ich entschuldige seine Tendenz, alles in sich hineinzufressen, nicht. Ich möchte nur sagen, dass ich absolut verstehe, warum er geschwiegen hat. Ich verstehe es, weil ich an dem gleichen Scheidepunkt stand.
Das ist mein Geschenk an Sue Klebold: ein Krümelchen Erkenntnis. Vielleicht weiß sie es schon und wahrscheinlich erreicht sie dieser Text niemals. Aber für den Fall, dass sie ihn doch liest und nicht in Betracht gezogen hat, dass Dylans Verschwiegenheit ein verdrehter Liebesbeweis war, wollte ich, dass sie es erfährt. Ich ringe noch immer mit mir, ob ich versuchen soll, ihr eine E-Mail zu schicken.
Ich hoffe von ganzem Herzen, dass „A Mother’s Reckoning“ etwas verändert. Ich hoffe, dass sie Eltern auf der ganzen Welt erreicht und sie anregt, sich über die Symptome von Depressionen bei Jugendlichen zu informierten. Ich wünsche mir, dass ihr überwältigend ehrlicher Seelenstrip hilft, Leben zu retten. Die Katastrophe, die ihre Welt in eine Hölle verwandelte, die furchtbaren Verbrechen, die ihr Sohn Dylan beging, müssen etwas Gutes bewirken. Es muss etwas Gutes daraus erwachsen. Das Columbine-Massaker darf nicht so stehen bleiben. Es darf nicht auf ewig eine Wunde in der Geschichte sein, sinnlos und grauenvoll. Ich glaube daran, dass das Universum nach Balance strebt und ich glaube, dass Sue Klebold und die Organisationen, mit denen sie zusammenarbeitet, die Waagschale ausgleichen können. Ich weiß, dass sie die Erlöse aus ihren Buchverkäufen komplett an Suizidpräventionsorganisationen spendet. Vielleicht glaubt auch Sue Klebold an das kosmische Gleichgewicht. Ich wünsche ihr mit ganzer Kraft, dass ihr Engagement ihr eines Tages Frieden bringt und sie die bedauernswerte Lektion, die Dylan sie lehrte, hinter sich lassen kann.
Abschließend möchte ich noch ein paar Worte an diejenigen schicken, die selbst ebenfalls mit Depressionen und Suizidalität kämpfen: ihr seid nicht allein. Ich weiß, dass man in der schwarzen Tiefe der Depression glaubt, man sei vollkommen isoliert, unverstanden und generell überflüssig. Ihr seid es nicht. Es gibt Menschen, die euch lieben und für die die Welt ohne euch grauer aussähe. Bitte, nehmt Hilfe in Anspruch. Nehmt euch kein Beispiel an Dylan Klebold, der seine negativen Gefühle so lange hinunterschluckte, bis er daran erstickte und sie ihn auffraßen. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß auch, dass zwischen der Erkenntnis, dass man Hilfe braucht und der aktiven Suche nach Hilfe Welten der Scham und Überwindung liegen. Der Kampf lohnt sich. Auch in Deutschland gibt es Organisationen, die euch die Hand reichen werden, wenn ihr darum bittet. Es ist okay, schwach zu sein. Es ist okay, Narben zu tragen. Gebt nicht auf. Lasst euch von euren Gefühlen nicht die Zukunft nehmen, die ihr verdient. Lasst es euch nicht nehmen, die Menschen zu werden, die ihr sein wollt. Es gibt immer einen Ausweg.
Bundesweite kostenlose Telefonnummer der TelefonSeelsorge:
0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 oder auch online unter www.telefonseelsorge.de
Hilfsangebote bei der Deutschen Gesellschaft zur Suizidprävention



 Log in with Facebook
Log in with Facebook