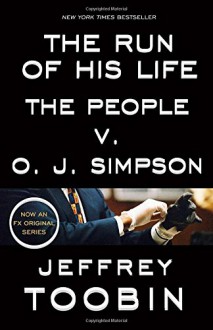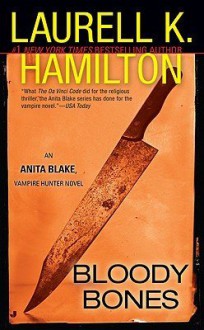Herzlich Willkommen zum zweiten Teil unseres dreiteiligen Rezensionsexperiments zum Thema „O.J. Simpson“. Gestern habe ich „The Run of His Life: The People V. O.J. Simpson” von Jeffrey Toobin besprochen und euch die Fakten des Strafprozesses gegen den ehemaligen Footballspieler nahegebracht. Heute widmen wir uns dem zweiten Buch in diesem Themenkomplex: „If I Did It: Confessions of the Killer“, O.J. Simpsons hypothetisches Geständnis der Morde an Nicole Brown Simpson und Ronald Goldman am 12. Juni 1994. Die Geschichte dieses höchst umstrittenen Werkes ist – wie so ziemlich alles, was Simpson betrifft – äußerst verzwickt, kompliziert und kann ausschließlich im Kontext des Zivilprozesses der Familien Goldman und Brown gegen Simpson betrachtet werden. Daher bin ich gezwungen, erneut weit auszuholen und Hintergrundinformationen zusammenzufassen. Ich verlange also wieder eine Menge Geduld von euch. ;-)
O.J. Simpsons Strafprozess wegen zweifachen vorsätzlichen Mordes an seiner Ex-Frau Nicole Brown Simpson und dem Kellner Ronald Goldman endete am 03. Oktober 1995 mit einem vollständigen Freispruch. Trotz der überwältigenden Beweislast befand ihn die 12-köpfige Trial Jury in allen Anklagepunkten als unschuldig. Da die Geschworenen ihr Urteil nicht begründeten, ist unklar, ob sie die Unschuldsvermutung zugunsten des Angeklagten anwendeten oder Simpson im Sinne der „Jury Nullification“ entgegen geltenden Rechts und der Beweise freisprachen.
Sollte O.J. Simpson jedoch geglaubt haben, er sei damit vom Haken, irrte er sich.
Bereits im Oktober 1995 wurde Fred Goldman (Rons Vater) der Anwalt Daniel Petrocelli empfohlen, der eine verlässliche Reputation als Zivilprozessanwalt vorweisen konnte. Goldman und Petrocelli trafen sich und beschlossen, eine Zivilklage wegen widerrechtlicher Tötung gegen O.J. Simpson anzustreben. Diese Entscheidung war mehr als ungewöhnlich. Jeffrey Toobin schrieb in „The Run of His Life: The People V. O.J. Simpson”, dass er keinen einzigen Präzedenzfall finden konnte, indem eine Zivilklage gegen eine Person angestoßen wurde, die in einem Strafprozess wegen Mordes von allen Anklagepunkten freigesprochen wurde.
Zivilprozesse unterliegen in den USA harmloseren Bedingungen als Strafprozesse. Zwar werden diese ebenfalls vor einer Jury verhandelt, während der Richter oder die Richterin als Moderator_in des Verfahrens fungiert, doch ihr Urteil muss nicht einstimmig sein. 9 von 12 Stimmen genügen für eine Verurteilung. Außerdem kommt der Grundsatz der Schuld „beyond reasonable doubt“ hier nicht zur Anwendung. Die Anklage muss lediglich eine überwiegend eindeutige Beweislage gegen den/die Beschuldigte_n präsentieren. Vermutlich rechneten sich die Goldmans und Daniel Petrocelli deshalb gute Chancen aus, Simpson dieses Mal erfolgreich zur Rechenschaft zu ziehen. Sie behielten Recht.
Petrocelli war im Vergleich zur Staatsanwaltschaft, vertreten von Marcia Clark und ihrem Team, zweifellos im Vorteil. Dem Zivilprozess, der im Oktober 1996 begann, wurde der Richter Hiroshi Fujisaki zugeteilt, der kurz darauf in den Ruhestand trat. Es war sein letzter Fall. Er scherte sich im Gegensatz zu Lance Ito nicht im Geringsten darum, ob er sich mit seinen Entscheidungen Feinde machte und hatte keinerlei Geduld für Selbstdarstellungen und lange Diskussionen in seinem Gerichtssaal. Simpsons Verteidigung, angeführt von Robert Baker, der darauf spezialisiert war, Versicherungsunternehmen in Kunstfehlerprozessen zu vertreten, biss sich an Fujisaki die Zähne aus.
Von Anfang an verbannte Fujisaki die berüchtigte „Rassenkarte“ aus seinem Prozess, was die Verteidiger zwang, eine alternative Strategie zu der im Strafprozess eingesetzten Verschwörungstheorie zusammenzuschustern. Da der Prozess allerdings in Santa Monica verhandelt wurde, wo die Bevölkerung überwiegend weiß war, hätten sie ohnehin Schwierigkeiten gehabt, die Jury mit dieser Theorie zu überzeugen. Sie entschieden, Simpsons Ruhm in den Mittelpunkt zu stellen und behaupteten, es sei unrealistisch, dass der ehemalige Footballstar, dem Frauen reihenweise zu Füßen lägen, seine Ex-Frau aus Eifersucht getötet habe. Vielmehr müsse jemand aus ihrem dubiosen Umfeld sie ermordet haben. Sie unterstellten Nicole Drogenprobleme und kriminelle Kontakte, wofür es keinerlei Beweise gab. Baker deutete an, durch ihren riskanten Lebenswandel sei Nicole indirekt selbst schuld an ihrem Tod. Victim Blaming in Reinkultur.
Die neue Strategie der Verteidigung fußte auf O.J. Simpsons persönlichem Auftritt als Zeuge. Durch seinen Freispruch im Strafprozess konnte er ohnehin nicht länger Gebrauch von seinem Recht machen, die Aussage zu verweigern. Er durfte in den Zeugenstand berufen werden und musste aussagen. Petrocelli nutzte die Gelegenheit, ihn ins Kreuzverhör zu nehmen, natürlich gnadenlos aus. Simpson schadete sich selbst massiv. Er präsentierte sich als unsympathisch, ungeduldig, arrogant und reagierte auf Widersprüche, die Petrocelli aufzeigte, mit aggressiver Starrköpfigkeit. Beispielsweise leugnete er weiterhin in drastischen Worten, ein Paar Schuhe der Marke Bruno Magli zu besitzen, die vom Spezialisten für Fuß- und Schuhabdrücke im Strafprozess mit den Abdrücken am Tatort in Verbindung gebracht worden waren. Nach dem Strafprozess tauchten Fotos von Simpson auf, in denen er eben jene Schuhe trug. Petrocelli führte sie mit Freuden vor. Ein ums andere Mal demaskierte er Simpson als Lügner.
Die Jury fällte ihr Urteil am 04. Februar 1997, nach etwa einer Woche der Beratungen. Die Geschworenen verurteilten O.J. Simpson zur Zahlung von insgesamt 33,5 Millionen Dollar an die Kläger_innen. Sie empfanden ihn als unglaubwürdig und waren von der Gültigkeit der physischen Beweise, wie zum Beispiel der DNA-Spuren, überzeugt. Kein einziges Mitglied der rechtsprechenden Jury war afroamerikanisch. Die einzige Person, die zugunsten des Beklagten entschieden hätte, fungierte als Ersatz und wurde nicht in den Dienst berufen. Sie war eine schwarze Frau in den mittleren Jahren.
Der Zivilprozess korrigierte die Fehlentscheidung der Jury im Strafprozess indirekt. Zwar war O.J. Simpson noch immer ein Mörder auf freiem Fuß, doch zumindest hatten die Browns und die Goldmans bewiesen, welches Unrecht er ihren Familien angetan hatte. Das Problem war, dass O.J. Simpson das völlig anders sah.
Die Jury verteilte die Summe, zu der sie Simpson verurteilte, wie folgt: die Browns sollten 12,5 Millionen Dollar Schadensersatz erhalten; den Goldmans sprachen sie 7 Millionen Dollar Entschädigung und ebenfalls 12,5 Millionen Dollar Schadensersatz zu. Sie befanden, dass der Beklagte verantwortlich für die Tode von Nicole Brown Simpson und Ronald Goldman war. Doch niemand erklärte den Familien, was sie tun sollten, falls sich O.J. Simpson weigerte, die geforderten Summen zu zahlen. Natürlich konnte Simpson 33,5 Millionen Dollar nicht aus dem Ärmel schütteln, schon gar nicht, nachdem er sich das unsagbar teure „Dreamteam“ im Strafprozess geleistet hatte. Der Punkt ist allerdings nicht, dass er nicht zahlen konnte, er wollte es nicht. Tatsächlich unternahm er alle möglichen und unmöglichen Schritte, um nicht zahlen zu müssen. Er zog nach Florida, weil dort Rentenbezüge und selbst bewohnte Immobilien nicht pfändbar sind. Er gründete Firmen im Namen seiner Kinder, um sein Einkommen vor dem Zugriff der Justiz zu schützen, während er sich selbst weiterhin munter bereicherte. Speziell die Goldmans kämpften jahrelang erbittert darum, ihn endlich zu fassen zu bekommen. Erfolglos. Und dann kam das Buch.
2006, 12 Jahre nach den Morden an Nicole Brown Simpson und Ronald Goldman, kündigte der Verlag HarperCollins eine Sensationsveröffentlichung an: ein Buch von O.J. Simpson, in dem er beschrieb, wie er die Morde begangen hätte, wäre er der Täter. Titel: „If I Did It“. Als die Familie Goldman davon erfuhr und herausfand, dass Simpson angeblich einen Vorschuss in Höhe von mehr als 1 Million Dollar erhalten hatte, waren sie entsetzt. Angewidert. Verletzt. Zornig. Sie starteten eine Gegenkampagne, um das Erscheinen des Buches zu verhindern. News Corp., der Mutterkonzern von HarperCollins, setzte sich daraufhin mit den Goldmans in Verbindung, um mit ihnen eine Entschädigungszahlung zu vereinbaren. Sie waren bereit, ihnen eine gewaltige Summe zu überlassen, aber nicht, die Veröffentlichung zu stoppen. Die Goldmans berieten sich mit den Browns, ob es richtig wäre, das Angebot anzunehmen. Welche Botschaft würde dieser Schritt der Öffentlichkeit vermitteln? Sie wurden ohnehin als geldgierig angefeindet; ihnen wurde vorgeworfen, auf O.J. Simpson herumzuhacken, weil sie versuchten, das Urteil des Zivilprozesses durchzusetzen. Am Ende eines sehr angespannten Wochenendes im November 2006 erhielten sie einen Anruf der Browns, denen News Corp. einen Bruchteil der Entschädigungssumme versprochen hatte, den sie den Goldmans angeboten hatten. Die Browns lehnten ab und die Goldmans ebenfalls. Stunden später wurde die Veröffentlichung von „If I Did It“ gestoppt.
Anwälte erteilten den Goldmans den Rat, offiziell Anspruch auf die Rechte am Buch zu erheben, wenn sie vermeiden wollten, dass es jemals das Licht der Welt erblickte. Erneut war die Familie hin- und hergerissen. Wollten sie wirklich Eigentümer eines Dokuments sein, das den Mord an einem der ihren beschrieb? Letztendlich siegte ihr Kampfeswille. Sie wollten O.J. Simpson davon abhalten, sich weiter durch den Mord an Ron zu bereichern. Sie entschieden, sich dieser schwierigen Aufgabe zu stellen. Bevor es jedoch zur Auktion der Rechte kommen konnte, meldete Simpsons Firma Lorraine Brooke Associates (LBA) Insolvenz an. LBA hatte als Strohfirma zwischen HarperCollins und O.J. Simpson gedient. Sie war nach den Zweitnamen seiner beiden Töchter, Arnelle Lorraine und Sydney Brooke, benannt. Arnelle wurde als Präsidentin geführt und seine Kinder aus der Ehe mit Nicole (Sydney und Justin) hielten jeweils 25% der Anteile der Firma. Auf diese Weise hätte Simpson ungefähr 630.000 Dollar mit der Veröffentlichung von „If I Did It“ verdient, auf die das Urteil des Zivilprozesses nicht anwendbar waren. Seine Familie befürwortete das Erscheinen des Buches übrigens.
Die Insolvenz von LBA war ein strategischer Schachzug. Die Anwälte der Scheinfirma hofften, die Rechte am Buch schützen zu können. Für die Goldmans gab es nun lediglich die Möglichkeit, das Manuskript vor das Konkursgericht zu zwingen. Sie waren demotiviert und resigniert, schöpften allerdings neue Hoffnung, als das Konkursgericht LBA als Scheinfirma einstufte. Es gelang ihnen, das Buch zur Verhandlung zu bringen. Der Richter hatte Erbarmen. Als größte Gläubiger (mit Zinsen schuldete ihnen Simpson zu diesem Zeitpunkt bereits 38 Millionen Dollar) wurden ihnen die Rechte an „If I Did It“ zugesprochen.
Die Konkursvereinbarung sah vor, dass sie das Buch veröffentlichen und 10% der Erträge an das Konkursgericht übergeben würden, womit weitere Schulden von LBA abbezahlt würden. Die Situation war zweifellos paradox. Mit diesem Manuskript würden sie helfen, die Schulden von Rons Mörder zu tilgen.
Der Weg bis zur Veröffentlichung 2007 war für die Goldmans lang, steinig und emotional äußerst aufwühlend. Mittlerweile hatten sie begriffen, dass es sich bei „If I Did It“ nicht um die befürchtete Anleitung zum Mord handelte, sondern um ein „hypothetisches“ Geständnis. O.J. Simpson beschrieb in eigenen Worten, wie und warum er seine Ex-Frau Nicole und Ron ermordet hatte. Dies zu lesen, muss unheimlich schmerzvoll gewesen sein. Im Vorwort der überarbeiteten Ausgabe berichtet die Familie, dass sie für die Entscheidung, das Buch zu veröffentlichen, harte Kritik ernteten. Erneut warf man ihnen vor, O.J. als Goldesel zu missbrauchen und sich an Rons Tod zu bereichern. Ich kann verstehen, wieso sie sich dazu durchrangen und ich glaube ihnen, dass sie es sich damit nicht leicht machten. Sie „missbrauchen“ den Mörder ihres Familienmitglieds nicht – sie fordern ein, was ihnen zusteht. Es geht nicht ums Geld. Es geht ums Prinzip. Es geht darum, dass jede Tat Konsequenzen hat und O.J. Simpson sich länger als ein Jahrzehnt Arme und Beine ausriss, um diese Konsequenzen zu umgehen. Mit dem Erscheinen von „If I Did It“, nun um den Untertitel „Confessions of the Killer“ erweitert, kamen sie ihrem Ziel, Gerechtigkeit für Ron zu erwirken, endlich ein Stück näher. 90% der Erlöse des Buches fließen in eine Stiftung in seinem Namen.
Als ich das erste Mal von „If I Did It“ las, traute ich meinen Augen nicht. Ich konnte es wirklich nicht fassen. Wer ist denn so dämlich, nach einem Freispruch ein „hypothetisches“ Geständnis zu verfassen und dieses als Buch veröffentlichen zu wollen? Mir ist zwar klar, dass man in den USA für dasselbe Verbrechen nicht mehrfach angeklagt werden kann, aber ich bitte euch. Wer macht sowas? Warum macht man sowas? Wenn man mit zweifachem Mord davongekommen ist, hält man den Mund und nimmt die Erinnerungen an die Tat mit ins Grab. Man zieht nicht los und erklärt der ganzen Welt, wie man es getan „hätte“, „wäre“ man der Mörder. Aus meiner Sicht verrät diese Handlungsweise sehr viel über O.J. Simpsons Persönlichkeit. Er erträgt es nicht, irrelevant zu sein. Er badet im Scheinwerferlicht, vollkommen unabhängig davon, ob die Aufmerksamkeit, die er erhält, positiv oder negativ ist. Übrigens ein Verhalten, das ich von meiner Hündin kenne. Als sie ein Welpe war.
„If I Did It“ auf meine Lektüreliste zum Fall O.J. Simpson zu setzen, hatte mehrere Gründe. Primär hoffte ich, durch dieses umstrittene Buch besser verstehen zu können, was für ein Mann Simpson ist. Seit ich die Details des Prozesses kannte, ging mir die Frage, wie er seelenruhig im Gerichtssaal hocken und zuschauen konnte, wie seine Verhandlung zur Farce mutierte, obwohl er wusste, dass er seine Ex-Frau und einen unschuldigen jungen Kellner ermordet hatte, nicht aus dem Kopf. Begriff er nicht, dass er für lange Zeit ins Gefängnis gehen könnte? Eine Zeit lang schwebte sogar die Todesstrafe im Raum. Hatte er denn keine Angst? Empfand er keine Schuld, keine Reue? Wenn schon nicht für Ron, dann zumindest für Nicole? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er wirklich dieser arrogante, eiskalte Bastard ist, der keine Miene verzieht, während über seine Zukunft verhandelt wird. Mit diesem Buch erhielt ich die Chance, in seinen Kopf zu gucken.
Zusätzlich erwartete ich, meine Auffassung des Falles um eine Facette erweitern zu können. Ich bemühte mich sehr um Objektivität und dazu gehörte meines Erachtens nach eben auch, den Angeklagten zu Wort kommen zu lassen.
Zu guter Letzt muss ich zugeben, dass in meine Entscheidung, das „hypothetische“ Geständnis lesen zu wollen, eine gute Portion Neugier und Sensationslust hineinspielte. Ich brannte darauf, zu erfahren, was O.J. Simpson über die Mordnacht zu sagen hatte. Sicherlich nicht die reinste Motivation, aber äußerst typisch für alles, was diesen Fall betrifft. Skandale faszinieren Menschen. Ich bin da keine Ausnahme.
Gut Mr. Simpson, dachte ich, dann lassen Sie mal hören.
„If I Did It: Confessions of the Killer” beginnt mit dem Vorwort der Familie Goldman, in dem sie zusammenfassen, welchen verschlungenen Weg sie einschlugen, bis das Buch in seiner aktuellen Form veröffentlicht wurde. Darauf folgt ein Prolog des Ghostwriters Pablo F. Fenjves. Fenjves, Fenjves… da klingelte etwas in meinem Hinterkopf. Ich kannte den Namen. Ich fand schnell heraus, woher. Fenjves hatte im Strafprozess gegen Simpson ausgesagt. Er war einer der Nachbarn, die Nicoles Akita hatten bellen hören, unmittelbar nach den Morden. Was für ein seltsamer Zufall. Mittlerweile glaube ich, dass es vielleicht gar kein Zufall war. Vielleicht wollte O.J. Simpson mit Fenjves arbeiten, aus welchen verworrenen Gründen auch immer. Während seines Prozesses hatte er persönlich in die Besetzung des „Dreamteams“ eingegriffen, warum also nicht bei diesem Projekt? Fenjves wurde gesagt, es handle sich mit Garantie um ein Geständnis, doch O.J. sei lediglich bereit, hypothetisch über die Morde zu sprechen.
Fenjves beschreibt seine Zusammenarbeit mit O.J. Simpson und schildert, wie sich der ehemalige Footballstar ihm gegenüber verhielt. O.J. fühlte sich mit dem Kapitel, das die Morde thematisiert, nicht wohl. Er hasste diesen Abschnitt und betonte immer wieder, dass er unschuldig sei. Fenjves glaubte ihm nicht. Nur mit Mühe konnte er eine Rekonstruktion der Tatnacht aus Simpson herauskitzeln. Als sie das Rohmaterial fertiggestellt hatten, begann Fenjves, zu schreiben. Er hielt engen Kontakt mit Simpson und nahm seinen Wünschen entsprechend Änderungen vor. Das Kapitel über die Morde blieb Diskussionsgegenstand. O.J. wollte es herausnehmen und strich wiederholt Details, die ausschließlich der Mörder wissen konnte. Er behauptete, Fenjves habe ihn zu fiktiven Spekulationen gedrängt. Er bekam kalte Füße. Es dämmerte ihm, was für eine irre Idee das Buch war. Trotz dessen stimmte er Fenjves‘ Manuskript letztendlich zu und es ging in die Produktion.
Die Medien bekamen Wind von dem Projekt und Proteste gegen das Buch wurden laut, besonders seitens der Goldmans. Der Inhaber von News Corp. stoppte die Veröffentlichung. O.J. Simpson kontaktierte Pablo F. Fenjves telefonisch, um ihm mitzuteilen, dass er sich trotz der massiven Kritik nicht gegen ihn wenden würde. Fenjves verstand nicht. O.J. erklärte, dass das Kapitel über die Morde hauptsächlich von Fenjves stammte, nicht von ihm. Das war selbstverständlich Quatsch. Es war O.J.s Buch. Er hatte ausreichend Gelegenheit, falsche Aussagen und Missverständnisse zu korrigieren. O.J. behauptete jedoch, er habe bewusst Fehler im Manuskript belassen, damit er sich später verteidigen könne. Fenjves war nicht glücklich mit der Unterstellung, er habe sich Passagen ausgedacht. O.J. log. Er habe die Zusammenarbeit mit Fenjves zwar geliebt und empfände das Projekt als kathartisch, es sei jedoch hauptsächlich darum gegangen, die Wahrheit über seine Beziehung zu Nicole öffentlich zu machen.
Fenjves begriff, dass Simpson versuchte, sich von dem Buch zu distanzieren. Einen Tag nach ihrem Telefonat wandte sich Simpson an die Presse und argumentierte, es sei fiktional und hauptsächlich das Werk seines Ghostwriters. Die Presse stürzte sich auf Fenjves. Es gab eine Menge Rummel. Alle Welt wollte Interviews oder die Chance, das Buch zu lesen. Fenjves lehnte alle Anfragen ab. Erst als die Goldmans die Rechte am Manuskript erwarben und Simpson erneut beteuerte, er habe mit dem Kapitel über die Morde nichts zu tun gehabt, äußerte er sich und erklärte, alles, was in „If I Did It“ stünde, sei O.J.s Gedankengut, inklusive aller Fehler, Andeutungen und Offenbarungen.
An dieser Stelle endet der Prolog. Mit dieser wirren Geschichte im Hinterkopf begann ich die Lektüre des originalen Manuskripts.
Jeder Mensch ist der Held seiner eigenen Geschichte. Im Fall O.J. Simpson ist das vermutlich zutreffender als bei irgendjemandem sonst. „If I Did It“ hat meine Meinung von O.J. Simpson definitiv verändert; ich musste mein Bild von ihm anpassen. Meine Wut auf ihn ist verraucht – übrig blieb trauriges Bedauern für einen Mann, der völlig den Kontakt zur Realität verlor.
Ich bin überzeugter denn je, dass Simpson schuldig ist. Meiner Ansicht nach ist dieses Buch tatsächlich ein lupenreines Geständnis. Das Possenspiel rund um die „hypothetische“ Mordnacht kaufe ich ihm nicht ab. Die Beschreibungen der Tat sind viel zu detailliert, konkret und glaubwürdig, um ein Produkt seiner Fantasie zu sein. Ich glaube jedoch, dass O.J. Simpsons nicht bewusst ist, dass er die Morde beging. Es handelt sich um einen Fakt, den er tief in seinem Unterbewusstsein wegschloss. Er spaltete seine Erinnerung an die Morde von sich ab. In der Psychologie ist lange bekannt, dass solche schützenden Strategien erstens möglich und zweitens nicht ungewöhnlich sind, wenn bestimmte Erlebnisse zu schrecklich sind, um sie zu verarbeiten. Schuld in diesem Ausmaß ist schrecklich. Allerdings funktioniert diese Strategie nicht ewig. „If I Did It“ beweist für mich, dass sich seine Erinnerungen Bahn brechen, obwohl er sich noch immer nicht eingestehen kann, dass er Nicole und Ron ermordete. Er kann die Realität nicht akzeptieren, deshalb griff er auf einen hypothetischen Ansatz zurück. Solange er die Morde lediglich in der Theorie begangen hat, kann er behaupten, unschuldig zu sein.
Ich denke, O.J. Simpson wurde missverstanden. Ich halte ihn nicht für einen kaltblütigen Killer, der von Bosheit und Niedertracht erfüllt ist. Meiner Einschätzung nach ist er ein Mann mit massivem Gewaltpotential, das impulsiv explodiert. Die Morde an Nicole und Ron waren verabscheuungswürdig und ich vermute, dass Simpson unter gravierenden psychischen und emotionalen Defiziten leidet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er plante, Nicole umzubringen (von Ron mal ganz zu schweigen, der unglücklicherweise zur falschen Zeit am falschen Ort war). Für einen vorsätzlichen Mord fehlt es ihm an Intelligenz, Weitsicht und Organisationstalent, was die zahllosen physischen Beweise, die am Tatort gefunden wurden, unterstützen. Er ist ein Mann mit geringer Aggressionsschwelle und Frustrationsgrenze. Nicole war für ihn ein Störfaktor, weil sie sich nicht so verhielt, wie er es sich wünschte. Ich bin sicher, dass er wirklich glaubte, sie ruiniere kontinuierlich sein Leben. Der Störfaktor musste unter Kontrolle gebracht werden. Dass sein Bedürfnis, Nicole zu kontrollieren, in dieser verhängnisvollen Nacht tödlich eskalieren könnte, hätte er sich selbst wahrscheinlich niemals zugetraut. Er ist meiner Meinung nach längst nicht so skrupellos und kalkulierend, wie Medien und Staatsanwaltschaft behaupteten.
Es ist wichtig, zu begreifen, dass O.J. Simpsons Realität nicht mit der Faktenlage korreliert. Er sieht sich als unschuldig, weil die Annahme seiner Schuld nicht mit seinem Bild von sich selbst vereinbar ist. An dieser Überzeugung hält er mit der Sturheit eines verzweifelten Mannes fest. Sie befähigt ihn, jegliche Widersprüche zu ignorieren oder weg zu erklären. Das ist schwer nachvollziehbar und ich musste mich sehr anstrengen, um seinem Weltbild zu folgen. Doch irgendwie gelang es mir, mich in ihn hineinzuversetzen und seine verschobene Perspektive einzunehmen. Dadurch entwickelte ich eine Ahnung davon, warum er sich überhaupt auf dieses absurde Buchprojekt einließ. Ich denke, er hat Pablo F. Fenjves die Wahrheit gesagt. Er wollte die öffentliche Wahrnehmung seiner Beziehung mit Nicole korrigieren und folglich auch die Wahrnehmung seiner Person. Er wollte das Narrativ ihrer Beziehung zu seinen Gunsten umdeuten.
Laut Jeffrey Toobin brachten Simpson Erwähnungen von häuslicher Gewalt im Strafprozess aus der Fassung. Im Zivilprozess verärgerten ihn Andeutungen, dass er Nicole anbettelte, ihrer Beziehung noch eine Chance zu geben. Für ihn ist es nicht mit seiner Realität vereinbar, dass Nicole nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte, weil er sie misshandelte und er dann zum Stalker wurde, der sie letztendlich tötete. Er musste die Situation umdrehen, um sich rechtfertigen zu können: seiner Meinung nach war Nicole diejenige, die ihre Beziehung unbedingt weiterführen wollte. Nicht sie, er fühlte sich bedrängt und verfolgt. Sie war diejenige, die ausflippte und gewalttätig wurde. Sie verhielt sich irrational und unberechenbar. Sie hatte Probleme. Er wollte Abstand. Er wollte die endgültige Trennung. Das Schlimme daran ist, dass ich denke, er glaubt tatsächlich alles, was er Fenjves aufschreiben ließ. Er verdrängt, ignoriert und leugnet alle Fakten, die seinem Bild von sich selbst als liebender, fürsorglicher, vernünftiger, rücksichtsvoller, verständnisvoller und geduldiger Ehemann, Vater, Ex-Mann, Sohn, Schwiegersohn und Freund widersprechen. Er beschreibt, wie er sich selbst sieht und wie er in der Öffentlichkeit gesehen werden möchte. Fehler seinerseits räumt er nur ein, um ihre Fehltritte zu betonen und sich selbst besser darstellen zu können. Dass dieses subjektive Porträt durch harte Tatsachen entkräftet wird, spielt für ihn keine Rolle. Seine Wahrnehmung ist meiner Ansicht nach komplett gestört: er ist der Gute, Nicole war die Böse.
„If I Did It“ beeinflusste meine Einschätzung von O.J. Simpson maßgeblich. Auf gewisse Weise konnte er sein Ziel also erfüllen. Ich bezweifle allerdings, dass er mit meinem Fazit zu diesem grotesken Buch zufrieden wäre. Ich gelangte zu der Überzeugung, dass O.J. Simpson, Promi, Runningback, Schauspieler, Golfer und Werbeikone, eine Kunstfigur ist. Ich glaube, den wahren Menschen hinter dieser Fassade, den Mann namens Orenthal James Simpson, bekommt kaum jemand jemals zu Gesicht. Vermutlich nicht mal er selbst. Meiner Ansicht nach kappte er den Kontakt zu sich selbst bereits vor langer Zeit. Ich denke, nicht O.J. Simpson tötete Nicole Brown Simpson und Ronald Goldman – Orenthal James Simpson tötete sie. In der Mordnacht eskalierte sein wahres Ich, nicht diese künstliche Hülle, die er den Medien zeigt. Durch diese Divergenz in seiner Persönlichkeit konnte er sich selbst glaubhaft weismachen, unschuldig zu sein. Ich möchte es ganz deutlich betonen: O.J. Simpson ist kein Lügner. Er glaubt, er ist unschuldig. In „If I Did It“ teilt er die Wahrheit mit, wie er sie interpretiert. Er verdreht und pervertiert, aber er lügt nicht.
Wie passt das Kapitel über die Morde in diese Theorie?
Simpsons eigentliches Geständnis nimmt lediglich geringen Raum im Buch ein, ca. 10 Seiten. Auf mich wirkten diese 10 Seiten ein bisschen wie ein Unfall. Vielleicht kann man von einer Verselbstständigung seines Unterbewusstseins sprechen. Ich glaube, Simpson wurde vom Momentum seiner Erzählsituation mit Pablo F. Fenjves mitgerissen. Obwohl Fenjves berichtete, es sei so mühselig wie Zähne ziehen gewesen, sein Gegenüber zum Reden zu bewegen, gelang es ihm mit ein paar psychologischen Tricks eben doch, Simpson ausreichend Sicherheit zu vermitteln, damit er sich öffnete. In der flauschigen, trügerischen Watte „hypothetischer“ Schilderungen rutschten ihm Details raus, die er vermutlich sogar vor sich selbst verbarg und die ihn meiner Meinung nach eindeutig als Mörder identifizieren. Ich stelle mir vor, wie es ihn eiskalt durchlief, als ihm klar wurde, was er verraten hatte. Orenthal James Simpson hatte sein hässliches Haupt gehoben. Interessant ist, dass O.J. Simpson innerhalb kürzester Zeit wieder die Kontrolle übernahm und sofort das Märchen erfand, Fenjves habe sich das Kapitel ausgedacht. Wie normal muss es für ihn sein, als Kunstfigur durchs Leben zu schreiten, um sein eigenes Verhalten problemlos leugnen und verzerren zu können?
Ich kann nicht leugnen, dass ich O.J. Simpson als Person bedauere. Er tut mir leid. Ich kann lediglich spekulieren, was ihn veranlasste, sich eine Kunstfigur zu erschaffen, sie unter allen Umständen zu schützen und als dominante Persönlichkeit zu etablieren. Einen Menschen, der niemals er selbst ist, der in einer illusorischen Traumwelt lebt und über keinerlei Kontakt zur Realität verfügt, kann ich nur bemitleiden. Das ändert jedoch nichts daran, dass er ein Mörder ist. Mein Mitleid spricht ihn nicht frei, das möchte ich keinesfalls suggerieren. „If I Did It“ ist ein Geständnis und verdient keine Sterne-Bewertung. O.J. Simpson ermordete Nicole Brown Simpson und Ronald Goldman. Für dieses schreckliche Verbrechen hätte er ins Gefängnis gehört.
Morgen werden wir uns mit den Erinnerungen einer Person beschäftigen, die meinem letzten Satz in dieser Rezension zweifellos zustimmen würde: Marcia Clark, die leitende Staatsanwältin im Strafprozess gegen O.J. Simpson. „Without A Doubt“ schildert die Verhandlung aus ihrer Perspektive und erklärt die Entscheidungen der Anklage, die in der Presse häufig als Inkompetenz verurteilt wurden. Berichten zufolge erhielt Clark für dieses Buch ein Honorar von mehr als 4 Millionen Dollar. Schaut morgen wieder vorbei, wenn ihr herausfinden wollt, ob die Chefanklägerin diese gewaltige Summe zurecht erhielt.



 Log in with Facebook
Log in with Facebook