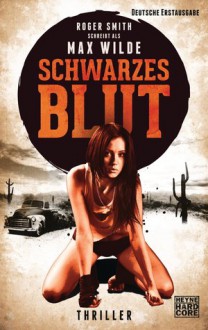Der zweite Band der „Lunar Chronicles“, „Scarlet“, spielt in Südfrankreich. Warum ausgerechnet Südfrankreich? Der Autorin Marissa Meyer wurde diese Frage oft gestellt. Südfrankreich verfügt über eine Besonderheit, die sie für sich nutzen wollte: einen historisch tief verwurzelten Glauben an Werwölfe. Es ist die Heimat der „Bestie des Gévaudan“, die zwischen 1764 und 1767 etwa 100 Menschen getötet haben soll. Bis heute ist nicht geklärt, was damals tatsächlich vorgefallen ist, doch die Bewohner_innen des Gévaudan waren fest überzeugt, dass sie von einem Loup Garou heimgesucht wurden – von einem Werwolf. Ein passenderes Setting für „Scarlet“ ist daher schwer vorstellbar. Schließlich handelt es sich um eine Variation des Märchens von „Rotkäppchen“ und dem großen, bösen Wolf.
Scarlet Benoit ist kurz davor, durchzudrehen. Ihre Großmutter ist seit über zwei Wochen spurlos verschwunden. Michelle Benoit mag exzentrisch sein, aber niemals würde sie ihre Enkelin und ihren kleinen Bauernhof im französischen Rieux ohne Nachricht verlassen. Scarlet ist überzeugt, dass ihr etwas zugestoßen ist. Verzweifelt klammert sie sich an jeden Strohhalm und lässt sich auf den zwielichtigen Straßenkämpfer Wolf ein, der behauptet, zu ahnen, wo ihre Großmutter festgehalten wird. Ohne zu wissen, ob sie Wolf trauen kann, begibt sie sich an seiner Seite auf eine halsbrecherische Rettungsmission, während sie pausenlos darüber nachgrübelt, warum ihre Großmutter entführt worden sein könnte. Hatte sie Geheimnisse vor Scarlet? Erst als die beiden der flüchtigen Cyborg Cinder begegnen, ergibt plötzlich alles einen Sinn…
Ich vergebe meine Sterne-Bewertungen nach Bauchgefühl. Manchmal kann ich an der Beurteilung, die mein Bauch im Alleingang vornimmt, intellektuell noch etwas drehen und ihn davon überzeugen, dass die Fakten eine andere Sprache sprechen, aber meistens ist er unbelehrbar und mir obliegt es, herauszufinden, warum er ein Buch so und nicht anders bewertet. Nach der Lektüre von „Scarlet“ bestand der Bauch auf eine 3-Sterne-Bewertung und schickte mir ein diffuses Gefühl von Enttäuschung. Es ist eindeutig, dass ich „Cinder“ besser fand – jetzt musste ich nur noch definieren, wieso. Leichter gesagt als getan. Ich grübelte lange. Erst dachte ich, die Enttäuschung stamme daher, dass ich keine solide Verbindung zur Protagonistin Scarlet aufbauen konnte. Ich finde sie seltsam flach charakterisiert, da ihr aufbrausendes Temperament die einzige Eigenschaft ist, die sie auszeichnet. Ich sah in ihr wenig Individualität und empfand sie als ernüchternd austauschbar. Ihr männlicher Gegenpart Wolf ist deutlich interessanter, weil ihm seine Unsicherheit auf die Stirn geschrieben steht und ich furchtbar neugierig war, welche Geheimnisse er hinter seiner distanzierten, verschlossenen Fassade verbirgt. Für mich war offensichtlich, dass Wolf kein normaler Mensch ist. Ich war entsetzt, wie blind Scarlet gegenüber seinen Eigenheiten ist. Sie vertraut ihm und entwickelt – typisch YA – innerhalb kürzester Zeit Gefühle für ihn, obwohl alles an Wolf nach einer gesunden Portion Skepsis schreit. Sie reist mit ihm durch die wunderschön atmosphärisch beschriebene Landschaft Südfrankreichs, ohne sein Verhalten anzuzweifeln. Ich glaube, Marissa Meyer wollte so die vertrauensvolle Naivität nachbilden, die Rotkäppchen dem großen, bösen Wolf entgegenbringt. Leider funktioniert diese Form von Beziehung nur im Märchen. In einem modernen Roman wirkt sie unrealistisch. Strukturell folgt „Scarlet“ grob dem Märchen, doch die idiosynkratischen Wiedererkennungsmerkmale fand ich, abgesehen von Scarlets feuerroten Haaren und ihrem roten Hoodie, weniger auffallend als im ersten Band. Der Großteil wurde mir erst nach der Lektüre bewusst. Vielleicht hatte Marissa Meyer nicht genügend Raum, um sie hervorstechend zu inszenieren, da sie zum ersten Mal intensiv mit Perspektivwechseln arbeitete. Ich war positiv überrascht, dass Cinder einen eigenen Handlungsstrang erhält, weil ich mit ihr besser zurechtkomme als mit Scarlet. Cinder gelingt es, aus dem Gefängnis zu flüchten, indem sie sich mit dem selbstbewussten, charmanten Kleinkriminellen Carswell Thorne verbündet, den ich trotz müheloser Sympathie kaum ernstnehmen konnte. Seine Rolle fungiert meiner Meinung nach ausschließlich als Gegenpol zu Cinders Schwermut; er ist der witzige Sidekick, dessen Aufgabe darin besteht, Situationen aufzulockern. Seine Figur ist nicht in sich selbst motiviert, sondern nur in seinem Verhältnis zu anderen Figuren. Ich fand ihn unecht und übertrieben.
All diese Kritikpunkte sind gute Gründe, „Scarlet“ lediglich mit 3 Sternen zu bewerten. Doch der Bauch war mit diesen Erklärungen noch nicht zufrieden. Er ließ mir keine Ruhe und zwang mich, tiefer zu graben. Ich grub und grub, bis ich endlich den Ursprung meiner sachten Enttäuschung freilegte: „Scarlet“ ist weniger originell als „Cinder“. Für mich enthält es zu wenig frische Ideen. Es unterscheidet sich kaum von einer popeligen YA-Dystopie aus der Durchschnittsecke und deshalb verdient es dem Bauch zufolge auch nur eine durchschnittliche Bewertung.
„Scarlet“ ist meiner Meinung nach schwächer als der Vorgänger „Cinder“. Trotz der respektvollen, angemessenen Verarbeitung des Märchens „Rotkäppchen“ büßt es durch die enge Anlehnung an genretypische Strukturen deutlich an Reiz ein. Das taffe Mädchen, der geheimnisvolle fremde Junge, Insta-Love und eine gefährliche Rettungsmission – sagt mir nicht, dass euch das nicht bekannt vorkommt. Leider lenken diese Elemente von der kreativen Gestaltung des futuristischen Universums ab, das Marissa Meyer im zweiten Band erfreulicherweise öffnet und erweitert. Ich bin gespannt, welche neuen Facetten ich im dritten Band „Cress“ erleben werde und wie Meyer die Jonglage mit drei Protagonistinnen meistert. Aschenputtel, Rotkäppchen und Rapunzel vereint – das verspricht, interessant zu werden.

 Log in with Facebook
Log in with Facebook